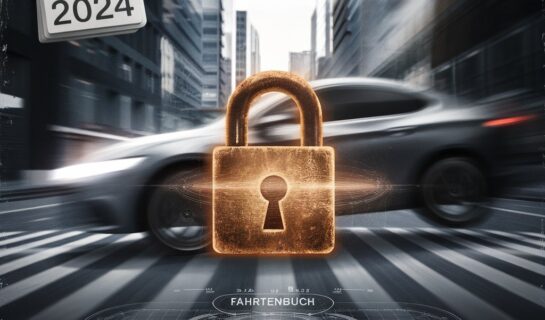Unter Abänderung des Urteils des Verwaltungsgerichts Trier vom 16. Oktober 2023 werden der Bescheid des Beklagten vom 8. Februar 2023 und der Widerspruchsbescheid des Kreisrechtsausschusses bei der Kreisverwaltung des Beklagten vom 15. Mai 2023 aufgehoben.
Der Beklagte hat die Kosten des Verfahrens beider Rechtszüge zu tragen.
Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
Die Revision wird zugelassen.
Tatbestand
Die Klägerin wendet sich gegen die Untersagung des Führens fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr.
Durch bestandskräftigen Bescheid vom 26. Juli 2021 wurde der Klägerin die Fahrerlaubnis für alle Klassen entzogen. Die Entziehungsentscheidung war darauf gestützt, dass in einer der Klägerin als Pkw-Fahrerin anlässlich einer Verkehrskontrolle entnommenen Blutprobe ausweislich des toxikologischen Befunds des Universitätsklinikums Mainz vom 30. April 2021 unter anderem 540 ng/mL Amphetamin, ca. 7,7 ng/mL Methylphenidat und ca. 600 ng/mL Ritalinsäure festgestellt wurden. Die forensischen Toxikologen PD Dr. R. und Dr. H. wiesen in dem Befund darauf hin, dass der Nachweis von Amphetamin in der Blutprobe nicht mit der Einnahme von Methylphenidat (z.B. Ritalin) erklärbar sei, da sich Letzteres weder durch Stoffwechselvorgänge noch durch anderweitige Abbauprozesse in Amphetamin umwandeln könne.
Am 14. Oktober 2022 wurde die Klägerin als Fahrerin eines Mofas (baubedingte Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h) ohne Helm erneut einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ausweislich der Einsatzmeldung der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues wurden bei ihr Ausfallerscheinungen (starkes Lidflattern, zitternde Fingerkuppen, stichnadelgroße Pupillen) festgestellt. Laut toxikologischem Befund der forensischen Toxikologen PD Dr. R. und Dr. W. des Universitätsklinikums Mainz vom 25. November 2022 wurden in der der Klägerin entnommenen Blutprobe durch eine Untersuchung mittels Flüssigkeitschromatographie-Tandem-Massenspektronomie 400 ng/mL Amphetamin, ca. 5,3 ng/mL Methylphenidat, ca. 160 ng/mL Ritalinsäure, sowie ca. 41 ng/mL bzw. ca. 21 ng/mL der Psychopharmaka Amisulprid bzw. Olanzapin nachgewiesen. Ausweislich der gutachterlichen Äußerung sei eine relevante Amphetamin-Konzentration festgestellt und eine Beeinflussung durch das psychostimulierende Betäubungsmittel Amphetamin zum Blutentnahmezeitpunkt anzunehmen.
Im Rahmen der behördlichen Anhörung zur beabsichtigten Untersagung des Führens von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen erklärte die Klägerin am 26. Januar 2023, dass sie keine Betäubungsmittel konsumiere. Sie nehme ausschließlich Ritalin ein, was aber den positiven Amphetaminbefund erkläre.
Mit Bescheid vom 8. Februar 2023 untersagte der Beklagte der Klägerin, fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr zu führen und forderte sie – unter Zwangsmittelandrohung – auf, ihre Mofaprüfbescheinigung spätestens drei Tage nach Zustellung des Bescheids bei ihm abzugeben. Zur Begründung wurde auf die durch das toxikologische Gutachten des rechtsmedizinischen Instituts des Universitätsklinikums Mainz vom 25. November 2022 nachgewiesene Einnahme von Amphetamin, die nicht mit der Einnahme von Methylphenidat (z.B. Ritalin) erklärbar sei, verwiesen. Durch die Einnahme von Amphetamin sei die Fahreignung in der Regel ausgeschlossen.
Mit Schreiben vom 22. Februar 2023 legte die Klägerin Widerspruch ein. Sie werde medikamentös mit der Höchstdosis Ritalin behandelt. Hauptwirkstoff sei Methylphenidathydrochlorid, wobei es sich um einen amphetaminartigen Wirkstoff handele, weshalb der Amphetaminbefund nicht verwundere. Auch der Gebrauchsinformation des Medikaments sei eindeutig zu entnehmen, dass Ritalin einen Einfluss auf Drogentests habe. Weiter müsse der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beachtet werden. Durch die Untersagung werde ihre Existenz zerstört. Sie arbeite als Restaurantleiterin in der Gastronomie in M. (Mosel). Da ihr letzter Bus um 22 Uhr fahre und sie von niemandem nachts abgeholt werden könne, müsse sie regelmäßig – ein pünktlicher Feierabend um 21:30 Uhr sei oft nicht möglich – 17 km nach Hause laufen, wofür sie etwa vier Stunden benötige. Dies könne sie auf Dauer nicht leisten, weshalb sie ihren Arbeitsplatz verlieren werde. Regelmäßige Taxifahrten seien nicht finanzierbar, da eine Fahrt aufgrund der Anfahrt des Taxis aus der nächsten Stadt etwa 70 Euro koste. Schließlich könne sie als Restaurantleiterin nicht die Tagesschicht übernehmen. Demgegenüber bestehe bei fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen keine allzu hohe Gefährdung. Zumindest für die Wegstrecke zur Arbeit müsse ihr erlaubt werden, das Fahrrad zu nutzen.
Im vorläufigen Entlassungsbrief der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie des Krankenhauses Bernkastel-Kues vom 28. Februar 2023 führte die Psychologin Frau N. zu einem stationären Krankenhausaufenthalt der Klägerin vom 23. Januar bis 27. Februar 2023 aus, ein – wohl dort durchgeführtes – Drogenscreening vom 9. Februar 2023 sei ausschließlich positiv für Amphetamine gewesen, was auf die aktuelle Medikation von Ritalin zurückzuführen sei. Mit E-Mail vom 25. Juli 2023 erklärte Dr. L., Chefarzt der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses Bernkastel-Kues, hierzu, er müsse diese Aussage korrigieren. Er sei damals der Meinung gewesen, von einem derartigen Einfluss einmal in einer Quelle gelesen zu haben. Eine neuerliche Recherche habe ergeben, dass er sich getäuscht habe und eine Verfälschung von Drogenscreenings auf Amphetamine durch Ritalin bzw. Methylphenidat offenbar nicht bekannt sei, obschon Methylphenidat chemisch zur Gruppe der Amphetamine gerechnet werde.
Laut Telefonvermerk vom 28. März 2023 erklärte die forensische Toxikologin Dr. W., Institut für Rechtsmedizin der Universitätsmedizin Mainz, gegenüber einer Mitarbeiterin des Beklagten, dass – hinsichtlich der Frage, ob die Einnahme von Ritalin den Amphetaminbefund beeinflusst haben könnte – beachtet werden müsse, dass es sich vorliegend nicht um einen Urinschnelltest handele, sondern um eine Blutprobe. Insoweit sei durch den toxikologischen Befund eindeutig nachgewiesen worden, dass Amphetamin eingenommen worden sei. Ein Urinschnelltest könne vielleicht positiv auf Amphetamin reagieren, nicht aber eine Blutprobe, die im Labor analysiert werde.
Der Kreisrechtsausschuss bei der Kreisverwaltung des Beklagten wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 15. Mai 2023 – zugestellt am 30. Mai 2023 – unter Bezugnahme auf die Begründung des Ausgangsbescheids zurück und führte ergänzend aus, dass ein Zusammenhang zwischen einer Behandlung mit Ritalin und dem Befund von Amphetamin im Blut der Klägerin ausweislich der gutachterlichen Ausführungen von PD Dr. R. im toxikologischen Gutachten vom 30. April 2021 wie auch der Auskunft von Frau Dr. W. vom 28. März 2023 ausgeschlossen sei. Da demnach der Tatbestand erfüllt sei, bestehe auf Rechtsfolgenseite kein Entschließungsermessen, sondern nur ein Auswahlermessen bezüglich Art und Umfang der Maßnahme. Dabei sei in der Regel die Anordnung von Auflagen nicht ausreichend, um den Straßenverkehr in hinreichendem Maße vor Gefahren zu schützen, weil sich mit der Feststellung der Nichteignung grundsätzlich eine abstrakte Gefährlichkeit des Betroffenen für den Straßenverkehr manifestiert habe. Es bestehe im Fall der Einnahme von Amphetamin regelmäßig eine Ermessensreduzierung auf Null.
Die Klägerin hat ihre am 23. Juni 2023 erhobene Klage im Wesentlichen unter Bezugnahme auf das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 17. April 2023 (11 BV 22.1234) damit begründet, § 3 der Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr – Fahrerlaubnis-Verordnung, FeV – sei keine taugliche Rechtsgrundlage für die Untersagung des Rechts, fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge im Straßenverkehr zu führen. Eine Übertragung der für das Führen von Kraftfahrzeugen geltenden Maßstäbe auf das Führen von Fahrrädern oder E-Scootern sei wegen des unterschiedlichen Gefahrenpotenzials nicht möglich. Das Fehlen rechtlicher Maßstäbe könne zu unverhältnismäßigen Verboten führen. Auch im Falle der Klägerin zeige sich der schwerwiegende Eingriff. Gerade in ländlichen Gebieten sei es in der Regel ohne ein Fahrzeug kaum möglich, zur Arbeit zu gelangen. Im Übrigen werde im vorläufigen Entlassungsbrief vom 28. Februar 2023 erklärt, dass bei der Einnahme von Ritalin bei einem Drogenscreening Amphetamin nachgewiesen werde.
Die Klägerin hat beantragt, den Bescheid des Beklagten vom 8. Februar 2023 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 15. Mai 2023 aufzuheben.
Der Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen.
Er hat die Auffassung vertreten, dass mit § 3 FeV eine verfassungskonforme Rechtsgrundlage zur Untersagung des Führens von Fahrzeugen im Straßenverkehr gegeben sei. Die Klägerin habe sich aufgrund ihres nachgewiesenen, wiederholten und erheblichen Amphetaminkonsums – und zwar im Zusammenhang mit dem Führen eines Fahrzeugs im Straßenverkehr – als ungeeignet zum Führen von Fahrzeugen im Straßenverkehr erwiesen. Im Übrigen habe Herr Dr. L. seine Aussage zu einer möglichen Beeinflussung des Amphetaminbefunds durch eine Einnahme von Ritalin korrigiert.
Das Verwaltungsgericht hat die Klage mit Urteil vom 16. Oktober 2023 abgewiesen. Die angegriffenen Bescheide seien rechtmäßig. Ermächtigungsgrundlage für das Verbot, fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge aller Art im öffentlichen Straßenverkehr zu führen, sei § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. y Straßenverkehrsgesetz in der Fassung bis zum 27. Juli 2021 – StVG a.F. – i.V.m. § 3 FeV. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. y StVG a.F. sei als Ermächtigungsnorm mit dem Grundgesetz vereinbar, insbesondere hinreichend bestimmt. Auch § 3 FeV verstoße nicht gegen die Gebote der hinreichenden Bestimmtheit und Verhältnismäßigkeit. Die dieser rechtlichen Einschätzung widersprechende Auffassung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs überzeuge nicht. Denn auch mit Blick auf das gegenüber Kraftfahrzeugen in der Regel geringere Gefährdungspotenzial des Führens fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge sei es mit den Anforderungen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes vereinbar, dass § 3 Abs. 2 FeV für die Klärung von Eignungszweifeln ohne weitere Differenzierung umfassend auf die strengen Anforderungen der §§ 11 ff. FeV verweise, die an sich auf die Prüfung der Eignung und Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen ausgerichtet seien. Zwar könnten die Gefahren, die von dem Führer eines erlaubnisfreien Fahrzeugs ausgingen, geringer einzustufen sein als diejenigen, die ungeeignete Kraftfahrer verursachten, die erlaubnispflichtige Fahrzeuge führten. Sie seien aber erheblich genug, um die entsprechende Anwendung der Vorschriften der §§ 11 bis 14 FeV für gerechtfertigt zu halten, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigten, dass der Führer eines Fahrzeugs oder Tieres zum Führen ungeeignet oder nur noch bedingt geeignet sei (§ 3 Abs. 2 FeV). Ebenso wenig unterliege es Bedenken, dass die Fahrerlaubnisbehörde das Führen von Fahrzeugen untersagen, beschränken oder die erforderlichen Auflagen anordnen könne, wenn sich der Betreffende als ungeeignet oder nur noch bedingt geeignet zum Führen von Fahrzeugen erweise (§ 3 Abs. 1 FeV). Dabei werde nicht verkannt, dass sich Fahrzeuge, die keine Kraftfahrzeuge seien, von letzteren insbesondere in Größe und Gewicht, den Fahreigenschaften, der erreichbaren Fahrgeschwindigkeit, in Bedienung und Art der Benutzung und damit in den Anforderungen an den Fahrer unterschieden. Entscheidend sei aber, dass die Gefahren, die vom Führer eines erlaubnisfreien Fahrzeugs ausgingen, mit denen eines Führers erlaubnispflichtiger Fahrzeuge vergleichbar seien. Verkehrsunfälle, die ungeeignete Fahrer erlaubnisfreier Fahrzeuge verursachten, könnten ebenfalls mit schwerwiegenden Folgen für Gesundheit und Leben anderer Verkehrsteilnehmer verbunden sein. Motorisierte Verkehrsteilnehmer, die sich schneller als Fahrradfahrer im Straßenverkehr bewegten, könnten sich und andere erheblich gefährden, wenn sie wegen der unvorhersehbaren Fahrweise eines etwa unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln fahrenden Fahrradfahrers ihrerseits zu riskanten und folgenschweren Ausweichmanövern verleitet würden. Darüber hinaus sei zu berücksichtigen, dass die §§ 11 ff. FeV nach dem ausdrücklichen Wortlaut des § 3 Abs. 2 FeV lediglich entsprechend Anwendung fänden. Die Einschränkung betreffe zunächst den Anwendungsbereich der Norm, der nur dann eröffnet sei, wenn die Regelung ihrem Inhalt nach nicht das Führen eines fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugs voraussetze. Mit Blick auf Anlage 4 zu den §§ 11, 13 und 14 FeV sei eine entsprechende Anwendung zudem nur möglich, soweit sich die Mängel auch auf das Führen von nicht fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen oder Tieren bezögen. Den bestehenden Unterschieden habe die Fahrerlaubnisbehörde ferner im Rahmen des ihr eingeräumten Auswahlermessens Rechnung zu tragen. Vorliegend seien die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Satz 1 FeV erfüllt. Aufgrund des toxikologischen Befundes der Universitätsklinik Mainz vom 25. November 2022 stehe fest, dass die Klägerin Betäubungsmittel in Form von Amphetamin zu sich genommen habe, weshalb nach Ziffer 9.1 der Anlage 4 zu den §§ 11, 13 und 14 FeV von ihrer Ungeeignetheit zum Führen von Fahrzeugen auszugehen sei. Dabei ergebe sich aus der gutachterlichen Äußerung von PD Dr. R. vom 30. April 2021 und der Auskunft von Frau Dr. W. vom 28. März 2023, dass ein Nachweis von Amphetamin nicht mit der Einnahme von (ebenfalls nachgewiesenem) Methylphenidat (z.B. Ritalin) erklärbar sei. Letzteres könne sich weder durch Stoffwechselvorgänge noch durch anderweitige Abbauprozesse in Amphetamin umwandeln. Auch der Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie des Krankenhauses Bernkastel-Kues habe eine vorherige, gegenteilige Aussage mit Email vom 25. Juli 2023 zurückgenommen.
Die Klägerin trägt mit ihrer vom Verwaltungsgericht zugelassenen Berufung unter Bezugnahme auf das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 17. April 2023 (11 BV 22.1234, juris) vor, § 3 FeV sei keine taugliche Rechtsgrundlage für das Verbot, fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge zu führen, da dieser die Anforderungen an die Eignung zum Führen fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge nicht hinreichend bestimmt regele und darüber hinaus unverhältnismäßig sei. § 3 Abs. 1 FeV ermächtige die Fahrerlaubnisbehörde zu schwerwiegenden Eingriffen in die durch die allgemeine Handlungsfreiheit geschützte Mobilität des Betroffenen. Wie die Klägerin seien von einer solchen Untersagung in der Regel Personen betroffen, die keine Kraftfahrzeuge (mehr) führen könnten. Diese Personen seien zur Fortbewegung, zur Erledigung der wesentlichen Dinge des täglichen Lebens, zur Erhaltung des Lebensunterhalts, zum Erreichen der Arbeitsstelle oder für Arztbesuche, dringend und zwingend darauf angewiesen, sich mit sonstigen Fahrzeugen fortbewegen zu können. Gerade – wie hier – im ländlichen Bereich sei öffentlicher Nahverkehr nur sehr rudimentär vorhanden. Arbeite man wie die Klägerin in der Gastronomie und ende die Arbeitszeit unregelmäßig und spät in der Nacht, bestehe keine Möglichkeit mehr, von der Arbeitsstelle nach Hause zu gelangen. Es zeige sich, dass das Verbot, fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge zu führen, den Einzelnen fast schwerer treffe als der Entzug der Fahrerlaubnis. Es treffe demgegenüber nicht zu, dass vom Führer erlaubnisfreier Fahrzeuge die gleiche Gefahr ausgehe wie von einem Führer erlaubnispflichtiger Fahrzeuge. Ein Fahrradfahrer stelle eine ganz andere Gefahr dar als der Führer eines Lkw, aber auch der eines Pkw. Ein Fahrradfahrer gefährde in der Regel höchstens sich selbst. Insoweit werde von der Rechtsprechung bei der Unfallschadenregulierung auch eine unterschiedliche Betriebsgefahr zugrunde gelegt. Der Gesetzgeber habe sich bewusst dafür entschieden, für verschiedene Fahrzeuge eine Fahrerlaubnis zu fordern und für andere nicht, da die Gefährdungslage eine völlig andere sei. Hinzu komme, dass auch etwa Personen auf Inline-Skates erhebliche Geschwindigkeiten erreichten, die einem Fahrradfahrer gleichkämen. Die Gefährdungslage sei identisch. Wenn mit Inline-Skates gefahren werden dürfe, könne das Führen von Fahrrädern nicht verboten werden. Schließlich müsste es in der Konsequenz der Argumentation des Verwaltungsgerichts auch dem Fußgänger verboten werden, sich auf der Straße fortzubewegen, da auch von ihm eine (mittelbare) Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer ausgehen könne, insbesondere könne auch er durch Fehlverhalten Unfälle mit erheblichen Konsequenzen verursachen. Für einen Eingriff in das Recht, fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge zu führen, müsse es klare und zweifelsfreie Regeln, Maßstäbe und Grenzwerte geben, die auf wissenschaftliche Feststellungen gestützt und gesetzlich festgelegt seien. Daran fehle es.
Die Klägerin beantragt, unter Abänderung des Urteils des Verwaltungsgericht Trier vom 16. Oktober 2023 den Bescheid des Beklagten vom 8. Februar 2023 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 15. Mai 2023 aufzuheben.
Der Beklagte beantragt, die Berufung zurückzuweisen.
Zur Begründung verweist er auf die angegriffene Entscheidung.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Beteiligten gewechselten Schriftsätze, die sonstigen zu den Akten gereichten Unterlagen, den Inhalt der Gerichtsakte sowie die beigezogenen Verwaltungsakten des Beklagten (zwei Hefte) Bezug genommen. Sämtliche Unterlagen lagen dem Senat vor und waren Gegenstand der Beratung.
Entscheidungsgründe
Die zulässige Berufung der Klägerin – über die das Gericht mit Einverständnis der Beteiligten nach § 101 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ohne mündliche Verhandlung entscheiden kann – ist begründet.
Der Bescheid vom 8. Februar 2023, mit dem der Beklagte der Klägerin das Führen fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr untersagt und sie aufgefordert hat, ihre Mofaprüfbescheinigung spätestens drei Tage nach Zustellung des Bescheids bei ihm abzugeben, sowie der Widerspruchsbescheid vom 15. Mai 2023 sind rechtswidrig und verletzen die Klägerin in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO), da die für die Untersagung herangezogene Rechtsgrundlage des § 3 der Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr vom 13. Dezember 2010 – Fahrerlaubnis-Verordnung, FeV (BGBl I S. 1980) –, diese zuletzt geändert durch die Verordnung vom 20. Juli 2023 (BGBl I Nr. 199), unwirksam ist. Sie genügt dem aus dem Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 bis 3 Grundgesetz – GG – folgenden Bestimmtheitsgebot sowie dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht (vgl. BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 30; Beschluss vom 12. Juli 2023 – 11 CS 23.551 –, juris Rn. 10; Beschluss vom 25. Juli 2023 – 11 CS 23.125 –, juris Rn. 26; VG Schwerin, Beschluss vom 27. Juli 2023 – 6 B 1855/22 SN –, juris Rn. 22; Müller/Rebler, DAR 2023, 437 [440 f.]; offen gelassen hinsichtlich § 3 Abs. 2 FeV in BVerwG, Urteil vom 4. Dezember 2020 – 3 C 5.20 –, BVerwGE 171, 1 = juris Rn. 38; SaarlOVG, Beschluss vom 3. Mai 2021 – 1 B 30/21 –, juris Rn. 40 ff.; zweifelnd auch Zwerger, jurisPR-VerkR 18/2022 Anm. 1; a.A. wohl OVG Nds, Beschluss vom 23. August 2023 – 12 ME 93/23 –, juris Rn. 10, jedenfalls bei der „typischen Fallgestaltung“ des im Anschluss an eine Trunkenheitsfahrt mit mehr als 1,6 ‰ BAK mit dem Fahrrad ausgesprochenen Verbots; Ternig, NZV 2024, 149; VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 16. November 2023 – 7 L 1617/23 –, juris).
I. Rechtsgrundlage für die mit Bescheid vom 8. Februar 2023 verfügte Untersagung des Führens fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge aller Art im öffentlichen Straßenverkehr ist § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. y Straßenverkehrsgesetz in der Fassung bis zum 27. Juli 2021 – StVG a.F. – i.V.m. § 3 Abs. 1 Satz 1 FeV in seiner aktuellen Fassung vom 21. Dezember 2016 (BGBl I S. 3083). Demgegenüber ist als Verordnungsermächtigung nicht § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b und d, Abs. 3 Nr. 1 StVG in der Fassung vom 12. Juli 2021 (BGBl. I S. 3091) heranzuziehen, weil für die Beurteilung der Vereinbarkeit einer Norm mit höherrangigem Recht auf den Zeitpunkt ihres Erlasses abzustellen ist und der Wegfall oder die Änderung der dem Erlass einer Rechtsverordnung zugrundeliegenden Ermächtigungsnorm jene grundsätzlich unberührt lässt (vgl. BVerwG, Urteil vom 24. Juni 2015 – 9 C 23.14 –, juris Rn. 10; Urteil vom 6. Oktober 1989 – 4 C 11.86 –, juris Rn. 10; BVerfG, Beschluss vom 10. Mai 1988 – 1 BvR 482/84 u.a. –, BVerfGE 78, 179 = juris Rn. 55; Beschluss vom 25. Juli 1962 – 2 BvL 4/62 –, BVerfGE 14, 245 = juris Rn. 16; Beschluss vom 23. März 1977 – 2 BvR 812/74 –, BVerfGE 44, 216 = juris Rn. 26; BayVGH m.w.N., Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 21 m.w.N.; Remmert, in: Dürig/Herzog/Scholz [Hrsg.], GG Kommentar, Stand: August 2023, Art. 80 Rn. 51; Dauer, in: Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 47. Aufl. 2023, § 3 FeV Rn. 10a).
II. Die Rechtsgrundlage für die Untersagung des Führens fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr des § 3 Abs. 1 Satz 1 FeV verletzt das aus dem Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 bis 3 GG abgeleitete Bestimmtheitsgebot (vgl. BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 33 ff.; Beschluss vom 25. Juli 2023 – 11 CS 23.125 –, juris Rn. 26 ff.; a.A. wohl OVG Nds, Beschluss vom 23. August 2023 – 12 ME 93/23 –, juris Rn. 10, jedenfalls bei der „typischen Fallgestaltung“ des im Anschluss an eine Trunkenheitsfahrt mit mehr als 1,6 ‰ BAK mit dem Fahrrad ausgesprochenen Verbots; VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 16. November 2023 – 7 L 1617/23 –, juris Rn. 80 ff.; Ternig, NZV 2024, 149).
1. Nach dem allgemeinen, im Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) gründenden Gebot hinreichender Bestimmtheit der Gesetze ist der Gesetzgeber gehalten, Vorschriften so bestimmt zu fassen, wie dies nach der Eigenart der zu ordnenden Lebenssachverhalte mit Rücksicht auf den Normzweck möglich ist. Die Betroffenen müssen die Rechtslage erkennen und ihr Verhalten danach ausrichten können. Die Anforderungen an die Bestimmtheit und Klarheit der Norm dienen ferner dazu, die Verwaltung zu binden und ihr Verhalten nach Inhalt, Zweck und Ausmaß zu begrenzen sowie die Gerichte in die Lage zu versetzen, die Verwaltung anhand rechtlicher Maßstäbe zu kontrollieren. Dies setzt voraus, dass hinreichend klare Maßstäbe bereitgestellt werden. Die Entscheidung über die Grenzen der Freiheit des Bürgers darf nicht einseitig in das Ermessen der Verwaltung oder gar Privater gestellt sein. Dabei sind die Anforderungen an den Grad der Klarheit und Bestimmtheit umso strenger, je intensiver der Grundrechtseingriff ist, den eine Norm rechtfertigen soll. Für die näheren Anforderungen kann, nicht zuletzt in der Frage, inwieweit Maßgaben, die sich aus dem Grundgesetz ableiten lassen, ausdrücklicher und konkretisierender Festlegung im einfachen Gesetz bedürfen, auch der jeweilige Kreis der Normanwender und Normbetroffenen von Bedeutung sein (vgl. zu Vorstehendem insgesamt BVerfG, Urteil vom 24. Juli 2018 – 2 BvR 309/15 –, BVerfGE 149, 293 = juris Rn. 77 m.w.N.; BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 31 m.w.N.; siehe ferner BVerfG, Beschluss vom 24. Juni 1993 – 1 BvR 689/92 –, BVerfGE 89, 69 = juris Rn. 60; Jarass, in: ders./Pieroth, GG, 17. Aufl. 2022, Art. 20 Rn. 82 ff.).
Grundsätzlich fehlt es an der notwendigen Bestimmtheit nicht schon deshalb, weil eine Norm auslegungsbedürftig ist. Das Bestimmtheitsgebot schließt die Verwendung wertausfüllungsbedürftiger Begriffe bis hin zu Generalklauseln sowie Verweisungen nicht aus. Der Gesetzgeber muss in der Lage bleiben, der Vielgestaltigkeit des Lebens Herr zu werden. Gegen die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe bestehen deshalb keine Bedenken, wenn sich mit Hilfe der üblichen Auslegungsmethoden, insbesondere durch Heranziehung anderer Vorschriften desselben Gesetzes, durch Berücksichtigung des Normzusammenhangs oder aufgrund einer gefestigten Rechtsprechung eine zuverlässige Grundlage für die Auslegung und Anwendung der Norm gewinnen lässt. Die Rechtsprechung ist zudem gehalten, verbleibende Unklarheiten über den Anwendungsbereich einer Norm durch Präzisierung und Konkretisierung im Wege der Auslegung nach Möglichkeit auszuräumen. Verweisungen müssen begrenzt bleiben und dürfen nicht durch die Inbezugnahme von Vorschriften, die andersartige Spannungslagen bewältigen, ihre Klarheit verlieren. In der Praxis darf es hierdurch nicht zu übermäßigen Schwierigkeiten bei der Anwendung kommen (vgl. zu Vorstehendem insgesamt BVerfG, Urteil vom 24. Juli 2018 – 2 BvR 309/15 –, BVerfGE 149, 293 = juris Rn. 78 m.w.N.; BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 31 m.w.N.; siehe ferner BVerfG, Beschluss vom 24. Juni 1993 – 1 BvR 689/92 –, BVerfGE 89, 69 = juris Rn. 60; Beschluss vom 4. Juni 2012 – 2 BvL 9/08 u.a. –, BVerfGE 131, 88 = juris Rn. 91, 101 f.).
Dabei lässt sich der Grad der für eine Norm jeweils erforderlichen Bestimmtheit nicht abstrakt festlegen, sondern hängt von den Besonderheiten des jeweiligen Tatbestands einschließlich der Umstände ab, die zur gesetzlichen Regelung geführt haben, sowie von der Intensität der Auswirkungen der Regelung für den Betroffenen bzw. der Art und Schwere des möglichen Eingriffs. Je bedeutsamer die Norm ist, insbesondere je intensiver der Grundrechtseingriff ist, den eine Norm vorsieht, und je eindeutiger, abgrenzbarer und vorhersehbarer der Regelungsgegenstand ist, desto höher ist das Maß der gebotenen inhaltlichen Bestimmtheit der Norm (vgl. zu Vorstehendem insgesamt BVerfG, Urteil vom 24. Juli 2018 – 2 BvR 309/15 –, BVerfGE 149, 293 = juris Rn. 78 m.w.N.; BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 31 m.w.N.; siehe ferner BVerfG, Beschluss vom 24. Juni 1993 – 1 BvR 689/92 –, BVerfGE 89, 69 = juris Rn. 60; Beschluss vom 4. Juni 2012 – 2 BvL 9/08 u.a. –, BVerfGE 131, 88 = juris Rn. 91, 101 f.).
Nicht hinnehmbar ist es, wenn es letztlich der Verwaltung obliegt, die Voraussetzungen und Grenzen eines Grundrechtseingriffs selbst zu bestimmen; wenn sie ohne nähere gesetzliche Vorgaben über die Grenzen der Freiheit des Bürgers entscheidet und sich die Maßstäbe dafür selbst zurechtlegen muss. Die Schaffung eingriffsbeschränkender Maßstäbe ist vielmehr Aufgabe des Gesetzgebers. Es ist insoweit in rechtsstaatlicher Hinsicht bedenklich, im Wesentlichen darauf zu vertrauen, dass eine unbestimmte Eingriffsermächtigung durch Auslegung seitens der Behörde, deren Verhalten gerade beschränkt werden soll, in gebotener Weise eingeengt wird (vgl. BVerwG, Beschluss vom 31. Mai 2022 – 6 C 2.20 –, juris Rn. 47).
2. Daran gemessen genügt § 3 FeV dem rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgebot nicht (vgl. BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 33 ff.; Beschluss vom 12. Juli 2023 – 11 CS 23.551 –, juris Rn. 10 ff.; Beschluss vom 25. Juli 2023 – 11 CS 23.125 –, juris Rn. 31; a.A. wohl OVG Nds, Beschluss vom 23. August 2023 – 12 ME 93/23 –, juris Rn. 10; Ternig, NZV 2024, 149).
a) Für die Ermächtigung zur Untersagung des Führens fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge sind nach vorstehendem Maßstab relativ strenge Anforderungen an deren Grad der Klarheit und Bestimmtheit zu stellen, da diese einen erheblichen Eingriff in grundrechtlich geschützte Freiheiten rechtfertigen soll.
Die Untersagung des Führens aller Arten von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen, zu der § 3 Abs. 1 Satz 1 FeV ermächtigt, stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die durch Art. 2 Abs. 1 GG gewährleistete allgemeine Handlungsfreiheit dar (so auch BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 32; Beschluss vom 25. Juli 2023 – 11 CS 23.125 –, juris Rn. 30; OVG RP, Urteil vom 17. August 2012 – 10 A 10284/12 –, juris Rn. 24; Beschluss vom 25. September 2009 – 10 B 10930/09 –, juris Rn. 8; siehe auch BVerwG, Urteil vom 4. Dezember 2020 – 3 C 5.20 –, BVerwGE 171, 1 = juris Rn. 39; SaarlOVG, Beschluss vom 3. Mai 2021 – 1 B 30/21 –, juris Rn. 46; OVG RP, Beschluss vom 8. Juni 2011 – 10 B 10415/11 –, juris Rn. 8; VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 16. November 2023 – 7 L 1617/23 –, juris Rn. 49; Müller/Rebler, DAR 2023, 437 [438, 441]; a.A. wohl OVG Nds, Beschluss vom 23. August 2023 – 12 ME 93/23 –, juris Rn. 10; vgl. zum tiefgreifenden Eingriff in das durch Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG geschützte allgemeine Persönlichkeitsrecht durch eine – hier nicht streitgegenständliche – Aufforderung zur Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens: BVerfG, Beschluss vom 24. Juni 1993 – 1 BvR 689/92 –, BVerfGE 89, 69 = juris Rn. 51 ff. 67; OVG RP, Urteil vom 17. August 2012 – 10 A 10284/12 –, juris Rn. 24; Beschluss vom 25. September 2009 – 10 B 10930/09 –, juris Rn. 9).
In der Rechtsprechung geklärt ist dies zunächst für die Entziehung einer Fahrerlaubnis. Insoweit steht nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dem öffentlichen Interesse an der Sicherheit des Straßenverkehrs das private Interesse eines Bürgers am Erwerb und Bestand einer Fahrerlaubnis gegenüber. Ihr Wegfall kann die persönliche Lebensführung und damit die Wahrnehmung grundrechtlicher Freiheiten des Erlaubnisinhabers und seiner Familie nachhaltig beeinflussen. Die Fahrerlaubnis hat für den Bürger nicht selten existenzsichernde Bedeutung. Ihre Entziehung kann insbesondere dazu führen, dass die Ausübung des Berufs eingeschränkt oder ganz aufgegeben werden muss (vgl. BVerfG, Beschluss vom 20. Juni 2002 – 1 BvR 2062/96 –, juris Rn. 50; siehe auch BVerwG, Urteil vom 5. Juli 2001 – 3 C 13.01 –, juris Rn. 22; Rebler/Müller, DAR 2014, 690 [695]).
Nach Auffassung des Senats handelt es sich bei der Untersagung des Führens fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge um einen (zumindest annähernd) vergleichbar gravierenden Eingriff (a.A. wohl OVG Nds, Beschluss vom 23. August 2023 – 12 ME 93/23 –, juris Rn. 10). So kann nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass Betroffene regelmäßig weniger zwingend auf beispielsweise ein Fahrrad oder ein Mofa angewiesen sind als auf ein Auto (a.A. OVG Nds, Beschluss vom 23. August 2023 – 12 ME 93/23 –, juris Rn. 10). Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass den Betroffenen beim Wegfall der Nutzung fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge keine hiermit annähernd vergleichbaren Fortbewegungsmöglichkeiten außerhalb des öffentlichen Personen- und Gelegenheitsverkehrs mehr verbleiben. Letzterer ist aber – wie sich nicht zuletzt auch am Beispiel der Klägerin zeigt – nicht nur mit nicht unerheblichen Kosten, sondern stets auch mit Einschränkungen der persönlichen Autonomie verbunden (siehe auch BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 32). Besonders schwer wiegt dies – wie der vorliegende Fall ebenfalls zeigt – im ländlichen Raum, in dem der öffentliche Personen- und Gelegenheitsverkehr partiell nicht oder nur sehr eingeschränkt verfügbar ist. Gerade dann kann der Wegfall dieser Fortbewegungsmöglichkeit – ob für Fahrten zum Arzt, zum Einkaufen, zur Ausübung des Berufs oder zur Ausbildung – die persönliche Lebensgestaltung und damit die Wahrnehmung grundrechtlicher Freiheiten des Betroffenen und seiner Familie fast ebenso gravierend beeinflussen wie der Wegfall einer Fahrerlaubnis (siehe auch BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 32; OVG RP, Urteil vom 17. August 2012 – 10 A 10284/12 –, juris Rn. 24; Beschluss vom 25. September 2009 – 10 B 10930/09 –, juris Rn. 8; Rebler/Müller, DAR 2014, 690 [695]). Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Fortbewegung zumindest mit Fahrzeugen, die keine Kraftfahrzeuge sind, grundsätzlich voraussetzungslos allen Personen – etwa auch kleineren Kindern – erlaubt ist (vgl. OVG RP, Urteil vom 17. August 2012 – 10 A 10284/12 –, juris Rn. 24; Beschluss vom 25. September 2009 – 10 B 10930/09 –, juris Rn. 8; Müller/Rebler, DAR 2023, 437 [438]). Schließlich wird die Eingriffsintensität nicht dadurch wesentlich entschärft, dass Betroffene weiterhin schlicht gehen oder „besondere Fortbewegungsmittel“ i.S.d. § 24 Abs. 1 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) – wie etwa Roller oder Inline-Skates –, die nicht als Fahrzeuge i.S.d. Fahrerlaubnisverordnung gelten, benutzen können (a.A. OVG Nds, Beschluss vom 23. August 2023 – 12 ME 93/23 –, juris Rn. 10). Denn während mit dem Fahrrad, Mofa oder den weiteren fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen i.S.d. Fahrerlaubnisverordnung durchaus auch weitere Strecken in überschaubarer Zeit zurückgelegt werden können und – etwa mit einem Lastenfahrrad – auch eine Transportmöglichkeit besteht, ist dies mit den verbleibenden Fortbewegungsmitteln oder „zu Fuß“ nicht in vergleichbarem Ausmaß möglich, insbesondere dann nicht, wenn es um eine weitere Strecke etwa zur Arbeit oder Ausbildungsstätte geht, die fast täglich zurückzulegen ist. Dies zeigt auch das Beispiel der Klägerin. So kann die knapp 15 Kilometer lange Wegstrecke vom (ehemaligen) Arbeitsplatz der Klägerin, dem Hotel A. in M. (Mosel), zu ihrem Wohnort in N.-D. laut Routenplaner (google maps) mit dem Fahrrad in etwa 55 Minuten zurückgelegt werden, wohingegen hierfür zu Fuß mehr als 3 Stunden benötigt werden.
b) Den mit der Erheblichkeit des Grundrechtseingriffs korrelierenden Bestimmtheitsanforderungen genügt § 3 Abs. 1 Satz 1 FeV nicht. Denn die Vorschrift stellt keine hinreichend klaren Maßstäbe bereit insbesondere für die Beurteilung der Frage, wann sich jemand als ungeeignet (oder nur noch bedingt geeignet) zum Führen von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen erweist und damit der Tatbestand für den Eingriff in Gestalt der Untersagung erfüllt ist. Gleiches gilt letztlich für die – hier nicht entscheidungserhebliche – Frage, wann nach § 3 Abs. 2 FeV Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Führer eines fahrerlaubnisfreien Fahrzeugs zum Führen ungeeignet (oder nur noch bedingt geeignet) ist und damit die Voraussetzungen für die Vornahme von Gefahrerforschungseingriffen erfüllt sind.
aa) So wird der Begriff der Ungeeignetheit zum Führen fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge – wie auch der der bedingten Eignung – in § 3 FeV selbst oder an anderer Stelle der Fahrerlaubnisverordnung nicht definiert oder weiter konkretisiert (siehe bereits OVG RP, Beschluss vom 25. September 2009 – 10 B 10930/09 –, juris Rn. 4 f.).
Die §§ 11 bis 14 FeV einschließlich der hierzu ergangenen Anlagen sind nach ihrem Wortlaut ausdrücklich auf die (bedingte) Eignung zum „Führen von Kraftfahrzeugen“ zugeschnitten (vgl. etwa § 11 Abs. 1 Satz 2, § 12 Abs.1 FeV). Aus der Regelungssystematik – die §§ 11 bis 14 FeV stehen im Abschnitt II.2 „Voraussetzungen für die Erteilung der Fahrerlaubnis“ – folgt zudem, dass speziell die Eignung zum Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge geregelt ist. Ebenso beziehen sich die §§ 13 und 14 FeV daran anknüpfend auf die Klärung von Eignungszweifeln zur Vorbereitung von Entscheidungen über die Erteilung oder Verlängerung der Fahrerlaubnis oder über die Anordnung von Beschränkungen oder Auflagen. Auch die Anlage 4 zu den §§ 11, 13 und 14 FeV regelt schon ausweislich ihrer Überschrift (nur) die Eignung und bedingte Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen. Die dortige Aufstellung „enthält häufiger vorkommende Erkrankungen und Mängel, die die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen längere Zeit beeinträchtigen oder aufheben können“ (Vorb. 1 der Anlage 4 zu den §§ 11, 13 und 14 FeV; siehe auch bereits OVG RP, Beschluss vom 25. September 2009 – 10 B 10930/09 –, juris Rn. 4 f.), wobei – ebenso wie in Anlage 6 zu den §§ 12, 48 Absatz 4 und 5 FeV – in der tabellarischen Aufstellung speziell auf die unterschiedlichen Fahrerlaubnisklassen Bezug genommen und insoweit sogar nochmals eine Binnendifferenzierung vorgenommen wird. Durch diese differenzierte Auflistung derjenigen Erkrankungen und Mängel, die die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen im Regelfall längere Zeit beeinträchtigen oder aufheben können, werden hinsichtlich der Kraftfahreignung die unbestimmten Rechtsbegriffe der körperlichen und geistigen Anforderungen konkretisiert (vgl. BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 33; Beschluss vom 25. Juli 2023 – 11 CS 23.125 –, juris Rn. 31). Für Fahrzeuge, die keine (fahrerlaubnispflichtigen) Kraftfahrzeuge sind, fehlt jedoch ein den Anlagen 4 bis 6 zur FeV vergleichbares Regelwerk (siehe dazu auch BVerwG, Urteil vom 14. November 2013 – 3 C 32.12 –, BVerwGE 148, 230 = juris Rn. 19).
Auch im Übrigen geben Wortlaut, Systematik und Sinn und Zweck des § 3 Abs. 1 FeV hinsichtlich des anzulegenden Eignungsmaßstabs allenfalls eine Zweckrichtung und einen Rahmen vor, konkrete Anforderungen und Maßstäbe, die es für den Betroffenen vorhersehbar machen würde, in welchen Fällen er mit einer Untersagung rechnen muss, und die das Verwaltungshandeln hinreichend binden und anhand rechtlicher Maßstäbe einer gerichtlichen Kontrolle unterwerfen könnten, lassen sich daraus aber nicht entnehmen.
bb) Hinreichend klare Maßstäbe – insbesondere für die Frage, wann von einer Eignung bzw. Ungeeignetheit zum Führen von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen auszugehen ist – lassen sich auch nicht im Wege einer historischen Auslegung nach dem Willen des Verordnungsgebers unter Rückgriff auf die Verordnungsmaterialien ermitteln. Dort heißt es:
„§ 3 gilt für Personen, die kein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug führen, sondern in anderer Weise am Straßenverkehr teilnehmen, z.B. für Fahrrad- und Mofafahrer und Lenker von Fuhrwerken. Er entspricht dem bisherigen § 3 StVZO. Der Eignungsbegriff ist im Straßenverkehrsgesetz selbst (§ 2 Abs. 4 StVG) definiert.“ (BR-Drucks. 443/98, S. 237)
Allerdings vermag der Verweis auf § 2 Abs. 4 StVG keine konkreten Vorgaben für die Eignung zum Führen fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge aufzustellen. § 2 Abs. 4 StVG in der Fassung vom 24. April 1998 (BGBl. I, S. 747) lautet (wie auch in seiner aktuellen Fassung):
„Geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen ist, wer die notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen erfüllt und nicht erheblich oder nicht wiederholt gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder gegen Strafgesetze verstoßen hat. Ist der Bewerber auf Grund körperlicher oder geistiger Mängel nur bedingt zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet, so erteilt die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis mit Beschränkungen oder unter Auflagen, wenn dadurch das sichere Führen von Kraftfahrzeugen gewährleistet ist.“
Da § 2 Abs. 4 StVG – der die Eignung aber auch ohnehin nur sehr abstrakt umschreibt – demnach wiederum ausschließlich die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen legaldefiniert, bietet dieser von vornherein keinen tauglichen Ansatzpunkt zur Bestimmung der Eignung zum Führen von denjenigen von § 3 FeV erfassten Fahrzeugen, die keine Kraftfahrzeuge sind (vgl. BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 33; Beschluss vom 25. Juli 2023 – 11 CS 23.125 –, juris Rn. 31; siehe auch BVerwG, Urteil vom 4. Dezember 2020 – 3 C 5.20 –, BVerwGE 171, 1 = juris Rn. 37; demgegenüber etwa OVG Nds, Beschluss vom 2. Februar 2012 – 12 ME 274/11 –, juris Rn. 5).
Weiter bringt auch der Verweis in der Verordnungsbegründung darauf, dass § 3 FeV dem bisherigen § 3 StVZO entspreche, nicht die gebotene Klarheit. § 3 Abs. 1 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der bis zum 31. Dezember 1998 gültigen Fassung vom 28. September 1988 – StVZO a.F. –, auf die sich der entsprechende Verweis in der Verordnungsbegründung bezieht, lautete:
„Erweist sich jemand als ungeeignet zum Führen von Fahrzeugen oder Tieren, so muß die Verwaltungsbehörde ihm das Führen untersagen oder die erforderlichen Auflagen machen; der Betroffene hat das Verbot zu beachten oder den Auflagen nachzukommen. Ungeeignet zum Führen von Fahrzeugen oder Tieren ist besonders, wer unter erheblicher Wirkung geistiger Getränke oder anderer berauschender Mittel am Verkehr teilgenommen oder sonst gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder Strafgesetze erheblich verstoßen hat.“
Zwar böte sich insoweit ein brauchbarer Ansatzpunkt, um den Begriff der Geeignetheit zum Führen von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen im Wege der historischen Auslegung weiter zu konkretisieren. Denn in § 3 Abs. 1 Satz 2 StVZO a.F. wurde die Ungeeignetheit näher bestimmt. Insoweit enger als unter der Geltung der § 11 bis 14 FeV einschließlich der hierzu ergangenen Anlagen war zumindest in dem gesetzlich ausdrücklich geregelten Fall Voraussetzung für eine Ungeeignetheit die Teilnahme am Verkehr unter erheblicher Wirkung geistiger Getränke oder anderer berauschender Mittel oder ein erheblicher Verstoß gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder Strafgesetze. Aber unbeschadet des Umstands, dass § 3 Abs. 1 Satz 2 StVZO a.F. ohnehin die Fälle der Ungeeignetheit nicht abschließend regelte („besonders“), hat eine dahingehende Konkretisierung des Eignungsbegriffs keinen erkennbaren Ausdruck im Wortlaut des § 3 FeV gefunden. Die (Verordnungs-)Materialien können bei der Auslegung von Normen indes nur unterstützend und insgesamt nur insofern herangezogen werden, als sie auf einen „objektiven“ Norminhalt schließen lassen. Die Materialien dürfen hingegen nicht dazu verleiten, den subjektiven Vorstellungen der gesetzgebenden Instanzen dem objektiven Norminhalt gleichzusetzen. Der sogenannte Wille des Normgebers bzw. der am Normgebungsverfahren Beteiligten kann hiernach bei der Interpretation nur insoweit berücksichtigt werden, als er auch im Text seinen Niederschlag gefunden hat (vgl. dazu BVerwG, Urteil vom 21. Februar 2013 – 5 C 9.12 –, BVerwGE 146, 89 = juris Rn. 16 m.w.N.). Daran fehlt es hier. Die Regelung des § 3 Abs. 1 StVZO a.F. wurde eben nur teilweise (hinsichtlich des Untersagungstatbestands), nicht aber vollständig in § 3 FeV überführt. So wurde die Legaldefinition der Ungeeignetheit des § 3 Abs. 1 Satz 2 StVZO a.F. gerade nicht in § 3 FeV übernommen. Auch ausweislich der Verordnungsbegründung sollte hinsichtlich des Eignungsbegriffs auf die (weitergehende) Regelung des § 2 Abs. 4 StVO verwiesen werden und damit gerade nicht auf § 3 Abs. 1 Satz 2 StVZO a.F.
cc) Die gebotene Konkretisierung des Eingriffstatbestands des § 3 Abs. 1 Satz 1 FeV lässt sich weiter nicht über eine Auslegung erreichen, nach der – obwohl ausschließlich § 3 Abs. 2 FeV für den Fall, dass Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Führer eines Fahrzeugs oder Tieres zum Führen ungeeignet oder nur noch bedingt geeignet ist, eine entsprechende Anwendung der §§ 11 bis 14 FeV anordnet, und demgegenüber in § 3 Abs. 1 FeV hinsichtlich einer (erwiesenen) Ungeeignetheit schon eine solche Verweisung fehlt – die für fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge geltenden Anforderungen der §§ 11 bis 14 FeV einschließlich der hierzu ergangenen Anlagen vollständig auf die Untersagung oder Beschränkung des Führens von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen angewendet würden – und damit identische physische und psychische Anforderungen an das Führen von fahrerlaubnispflichtigen und -freien Fahrzeugen gestellt würden (vgl. BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 35). Bei einer solchen Auslegung – bei der im zur Entscheidung stehenden Fall die Tatbestandsvoraussetzungen für die angegriffene Untersagungsverfügung vorlägen (dazu 1) – wäre die Vorschrift zwar wohl als hinreichend bestimmt anzusehen (dazu 2), lässt sich aber nicht mit dem im Rechtsstaatsgebot des Art. 20 Abs. 3 GG verankerten Verhältnismäßigkeitsgrundsatz vereinbaren (dazu 3).
(1) Wird die Frage, ob sich die Klägerin als ungeeignet zum Führen von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen erwiesen hat (§ 3 Abs. 1 Satz 1 FeV), anhand der Maßstäbe der §§ 11 bis 14 FeV einschließlich der Anlage 4 zu den §§ 11, 13 und 14 FeV beurteilt, wäre das Vorliegen der Voraussetzungen für die angegriffene Untersagung zu bejahen.
(a) Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage ist für die zu entscheidende Anfechtungsklage der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung bzw. bei einem – wie hier erfolgten – Verzicht der Beteiligten auf mündliche Verhandlung der Zeitpunkt, zu dem die Geschäftsstelle das vollständig abgesetzte Urteil zum Zwecke der Zustellung zur Versendung gebracht hat (vgl. BVerwG, Urteil vom 4. Dezember 2020 – 3 C 5.20 –, BVerwGE 171, 1 = juris Rn. 10-14; BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 23).
(b) Die Klägerin hat sich – unterstellt, die für fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge geltenden Eignungsanforderungen wären hier identisch anzuwenden – gemäß § 11 Abs. 1 FeV i.V.m. Ziffer 9.1 Anlage 4 zu den §§ 11, 13 und 14 FeV als ungeeignet zum Führen von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen erwiesen; auch einer vorhergehenden Begutachtung bedurfte es nicht (vgl. § 11 Abs. 7 FeV). Nach Ziffer 9.1 der Anlage 4 zu den §§ 11, 13 und 14 FeV fehlt die Eignung oder bedingte Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen bei der Einnahme von Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes (ausgenommen Cannabis). Damit folgt bei Vorliegen der Voraussetzungen der Ziffer 9.1 Anlage 4 zu den §§ 11, 13 und 14 FeV im Regelfall hieraus zugleich die Nichteignung zum Führen von Kraftfahrzeugen. Denn hierfür genügt bereits der (bewusste) einmalige Konsum sog. harter Drogen, unabhängig von der Höhe der Betäubungsmittelkonzentration, von einer Teilnahme am Straßenverkehr in berauschtem Zustand und vom Vorliegen konkreter Ausfallerscheinungen beim Betroffen (vgl. z.B. OVG RP, Beschluss vom 7. März 2018 – 10 B 10142/18.OVG –, juris Rn. 3; Beschluss vom 15. Oktober 2014 – 10 B 10897/14.OVG –, n.V.; BayVGH, Beschluss vom 5. Oktober 2023 – 11 CS 23.1413 –, juris Rn. 11; OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 26. Oktober 2022 – 3 M 88/22 –, juris Rn. 5; OVG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 11. Februar 2022 – 5 MB 2/22 –, juris Rn. 9; SaarlOVG, Beschluss vom 25. April 2018 – 1 B 105/18 –, juris Rn. 10; siehe auch SächsOVG, Beschluss vom 26. Juli 2023 – 6 A 1/21 –, juris Rn. 7). Auf Grundlage des toxikologischen Befunds der Universitätsklinik Mainz vom 25. November 2022 steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass die Klägerin Amphetamin – und damit ein Betäubungsmittel (vgl. § 1 Betäubungsmittelgesetz – BtMG – i.V.m. Anlage III zu § 1 Abs. 1 BtMG) – konsumiert hat. Die Klägerin hat ihre Behauptung aus dem erstinstanzlichen Verfahren, sie habe entgegen der Feststellungen im toxikologischen Befundbericht tatsächlich kein Amphetamin konsumiert und der diesbezügliche Befund liege in ihrer ärztlich verschriebenen Behandlung mit Ritalin begründet, im Berufungsverfahren nicht mehr aufgegriffen. Dafür bestehen unter Berücksichtigung der Auskünfte von PD Dr. R. vom 30. April 2021 und von Frau Dr. W. vom 28. März 2023, wonach ein Nachweis von Amphetamin nicht mit der Einnahme von (ebenfalls nachgewiesenem) Methylphenidat (z.B. Ritalin) erklärbar sei, sowie der E-Mail von Herrn Dr. L. vom 25. Juli 2023 auch keine Anhaltspunkte (siehe dazu auch BayVGH, Beschluss vom 31. Mai 2007 – 11 C 06.2695 –, juris Rn. 22; VG Gelsenkirchen, Urteil vom 12. Mai 2020 – 9 K 4276/19 –, juris Rn. 30). Zur weiteren Begründung wird insoweit auf die zutreffenden Gründe der angegriffenen Entscheidung verwiesen. Steht die Nichteignung der Klägerin zum Führen von Fahrzeugen auf dieser Grundlage zur Überzeugung der Fahrerlaubnisbehörde fest, wären die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Satz 1 FeV als erfüllt anzusehen und der Klägerin wäre das Führen fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge zu untersagen gewesen. Auch die (bloße) Anordnung von Beschränkungen oder Auflagen käme insoweit nach Ziffer 9.1 Anlage 4 zu den §§ 11, 13 und 14 FeV grundsätzlich nicht in Betracht.
(2) Bei einer Auslegung des § 3 Abs. 1 Satz 1 FeV in vorgenanntem Sinne wäre die Vorschrift – nicht zuletzt auch unter Berücksichtigung der umfangreichen Rechtsprechung zu den §§ 11 bis 14 FeV einschließlich der Anlage 4 zu den §§ 11, 13 und 14 FeV – zwar wohl als hinreichend bestimmt anzusehen, da die Folgen der Regelung für den Normadressaten insgesamt genügend vorhersehbar und berechenbar wären und der Verwaltung angemessen klare Handlungsmaßstäbe vorgegeben würden.
(3) Die Auslegung des § 3 Abs. 1 Satz 1 FeV, nach der die Regelungen der §§ 11 bis 14 FeV einschließlich der hierzu ergangenen Anlagen vollständig auf die Untersagung oder Beschränkung des Führens von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen angewendet werden – und damit auch identische physische und psychische Anforderungen an das Führen von fahrerlaubnispflichtigen und -freien Fahrzeugen gestellt werden – steht aber mit dem im Rechtsstaatsgebot des Art. 20 Abs. 3 GG verankerten Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (vgl. BVerwG, Urteil vom 24. Mai 2018 – 3 C 25.16 –, BVerwGE 162, 146 = juris Rn. 9) nicht in Einklang. Bei einem solchen Verständnis der Vorschrift ist diese nicht verhältnismäßig im engeren Sinne (vgl. BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 35, 41; Beschluss vom 12. Juli 2023 – 11 CS 23.551 –, juris Rn. 10 ff.; Beschluss vom 25. Juli 2023 – 11 CS 23.125 –, juris Rn. 26 ff.; siehe ferner auch Geiger, SVR 2007, 161 [162]; Kettler, SVR 2015, 7 [10]; offen gelassen hinsichtlich § 3 Abs. 2 FeV in BVerwG, Urteil vom 4. Dezember 2020 – 3 C 5.20 –, BVerwGE 171, 1 = juris Rn. 38; siehe demgegenüber etwa ThürOVG, Beschluss vom 9. Mai 2012 – 2 SO 596/11 –, juris Rn. 8).
Eine normative Beschränkung grundrechtlich geschützter Freiheiten ist verhältnismäßig im engeren Sinne, wenn bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe die Grenze der Zumutbarkeit noch gewahrt ist (vgl. BVerfG, Beschluss vom 5. Dezember 2005 – 1 BvR 1730/02 –, juris Rn. 20; Beschluss vom 22. April 2009 – 1 BvR 121/08 –, juris Rn. 40, jeweils m.w.N.; Beschluss vom 17. Oktober 1990 – 1 BvR 283/85 –, BVerfGE 83, 1 = juris Rn. 74). Daran fehlt es.
(a) Die Untersagung oder Beschränkung des Führens von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen nach § 3 Abs. 1 Satz 1 FeV dient – ebenso wie die Entziehung von Fahrerlaubnissen – dem legitimen Zweck, den fahrungeeigneten Verkehrsteilnehmer davon abzuhalten, aktiv mit einem Fahrzeug am öffentlichen Straßenverkehr teilzunehmen. Dadurch sollen von ihm ausgehende Gefahren für die Sicherheit des Straßenverkehrs und damit verbundene Gefahren für Leben, Gesundheit und Eigentum anderer Bürger abgewendet werden (vgl. BVerfG, Beschluss vom 20. Juni 2002 – 1 BvR 2062/96 –, juris Rn. 48 zur Entziehung einer Fahrerlaubnis nach § 4 StVG a.F. und § 15 b Abs. 1 StVZO a.F.; Beschluss vom 24. Juni 1993 – 1 BvR 689/92 –, BVerfGE 89, 69 = juris Rn. 61; siehe auch Borgmann, NZV 2023, 300 [306 Rn. 40]).
(b) Die Untersagung des Führens aller Arten von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen, zu der § 3 Abs. 1 Satz 1 FeV ermächtigen soll, stellt – wie bereits unter II. 2. a) dargelegt – einen schwerwiegenden Eingriff in die durch Art. 2 Abs. 1 GG gewährleistete allgemeine Handlungsfreiheit dar.
(c) Bei einer Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der ihn rechtfertigenden Gründe wahrt die Ermächtigungsgrundlage des § 3 Abs. 1 Satz 1 FeV – bei einer vollständigen Übertragung der §§ 11 bis 14 FeV einschließlich der hierzu ergangenen Anlagen auf die Untersagung des Führens fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge – die Grenze der Zumutbarkeit nicht. So erscheint es trotz des hohen Schutzguts unter Berücksichtigung einerseits der Eingriffsintensität der Untersagung des Führens fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge für den Betroffenen und andererseits des hiervon ausgehenden – im Verhältnis zum Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge – geringeren Sicherheitsrisikos für den öffentlichen Straßenverkehr nicht zumutbar, dieselben hohen Eignungsanforderungen, insbesondere identische physische und psychische Anforderungen, für das Führen von Kraftfahrzeugen und von fahrerlaubnisfreien Fahrzeuge anzuwenden (so auch BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 35, 41 m.w.N.).
(aa) Zwar dient die Untersagung des Führens fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge mit dem Interesse der Allgemeinheit an der Sicherheit des Straßenverkehrs und dem aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ableitbaren Auftrag zum Schutz vor erheblichen Gefahren für Leib und Leben (vgl. BVerfG, Beschluss vom 20. Juni 2002 – 1 BvR 2062/96 –, juris Rn. 52) einem sehr hohen Gut.
(bb) Dieses hohe Gut gebietet es – wenn das Führen von Kraftfahrzeugen in Rede steht –, hohe Anforderungen an die Eignung zu stellen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 20. Juni 2002 – 1 BvR 2062/96 –, juris Rn. 52; Beschluss vom 24. Juni 1993 – 1 BvR 689/92 –, BVerfGE 89, 69 = juris Rn. 61). Insoweit gilt aber auch bei der Entziehung einer Fahrerlaubnis, dass der Betroffene die absehbaren negativen Folgen einer Fahrerlaubnisentziehung für seine persönliche Lebensführung (nur) hinnehmen muss, wenn hinreichender Anlass zu der Annahme besteht, dass aus seiner aktiven Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr eine Gefahr für dessen Sicherheit resultiert. Das Sicherheitsrisiko muss deutlich über demjenigen liegen, das allgemein mit der Zulassung von Personen zum Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr verbunden ist (vgl. BVerfG, Beschluss vom 20. Juni 2002 – 1 BvR 2062/96 –, juris Rn. 51). Angesichts der vergleichbaren Eingriffsintensität gilt dies entsprechend für die Untersagung des Führens fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge. Auch insoweit ist der Eingriff nur zumutbar, wenn hinreichender Anlass zu der Annahme besteht, dass aus der aktiven Teilnahme des Betroffenen am öffentlichen Straßenverkehr eine Gefahr für dessen Sicherheit resultiert, wobei auch hier das Sicherheitsrisiko deutlich über demjenigen liegen muss, das allgemein mit der Zulassung von Personen zum Führen von Kraftfahrzeugen – und nicht bloß von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen – im öffentlichen Straßenverkehr verbunden ist. Denn auszugehen ist auch hier von dem Gefahrenpotential, das nach der gesetzgeberischen Wertung im öffentlichen Straßenverkehr allgemein toleriert wird. Dieses bemisst sich nach der von Kraftfahrzeugen ausgehenden höheren Gefährlichkeit (siehe auch OVG RP, Beschluss vom 8. Juni 2011 – 10 B 10415/11 –, juris Rn. 9). Nur die deutliche Steigerung der dem öffentlichen Straßenverkehr damit ohnehin innewohnenden Gefährlichkeit durch den Betroffenen vermag deshalb dessen Ausschluss hiervon zu rechtfertigen.
(cc) Da von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen allerdings nicht die gleiche Gefährlichkeit ausgeht wie von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen, kann eine solche deutliche Steigerung des Sicherheitsrisikos durch das Führen eines fahrerlaubnisfreien Fahrzeugs nicht ohne weiteres auf Grundlage der gleichen – strengen – Kriterien angenommen werden wie sie für das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge zulässig sind.
So unterscheiden sich Fahrzeuge, die keine Kraftfahrzeuge sind, von Kraftfahrzeugen insbesondere in Größe und Gewicht, den Fahreigenschaften, der erreichbaren Fahrgeschwindigkeit, in der (Komplexität der) Bedienung und Art der Benutzung und damit in den Anforderungen an den Fahrer und in ihrem Gefahrenpotential (vgl. BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 35 m.w.N.; Beschluss vom 25. Juli 2023 – 11 CS 23.125 –, juris Rn. 31; siehe auch BVerwG, Urteil vom 4. Dezember 2020 – 3 C 5.20 –, BVerwGE 171, 1 = juris Rn. 38; SaarlOVG, Beschluss vom 3. Mai 2021 – 1 B 30/21 –, juris Rn. 46; OVG RP, Urteil vom 17. August 2012 – 10 A 10284/12 –, juris Rn. 24, 27; Beschluss vom 8. Juni 2011 – 10 B 10415/11 –, juris Rn. 8, 10; Beschluss vom 25. September 2009 – 10 B 10930/09 –, juris Rn. 8, 10; siehe bereits BVerfG, Beschluss vom 27. März 1979 – 2 BvL 7/78 –, BVerfGE 51, 60 = juris Rn. 56, 62 f., wonach der Grad der Gefahr, die generell von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr ausgehe, maßgeblich davon abhänge, welche Geschwindigkeit sie zu erreichen vermögen, wobei mit zunehmender Geschwindigkeit die Gefahr wachse). Dabei greift diese Unterscheidung jedenfalls hinsichtlich der erreichbaren Fahrgeschwindigkeit auch zwischen fahrerlaubnisfreien und fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 27. März 1979 – 2 BvL 7/78 –, BVerfGE 51, 60 = juris Rn. 56, 62 f.). Ein weiterer Unterschied liegt darin, dass Fahrer fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge nicht die Autobahnen oder vergleichbar ausgebaute Schnellstraßen mit einer hohen Verkehrsdichte benutzen und gerade innerorts der gesamte Straßenverkehr langsamer fließt (vgl. OVG RP, Urteil vom 17. August 2012 – 10 A 10284/12 –, juris Rn. 27; Beschluss vom 25. September 2009 – 10 B 10930/09 –, juris Rn. 10).
Aus den geschilderten, zwischen fahrerlaubnispflichtigen und fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen bestehenden Unterschieden (insbesondere der erreichbaren Höchstgeschwindigkeit), können sich dabei zunächst genuin unterschiedliche körperliche und geistige Anforderungen für die sichere Beherrschung des jeweiligen Fahrzeugs im Straßenverkehr ergeben (denkbar etwa hinsichtlich des erforderlichen Seh- und Reaktionsvermögens).
Darüber hinaus geht von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen mit Blick auf vorgenannte Aspekte aber auch per se eine geringere Gefährlichkeit aus, weshalb die Schwelle für die Annahme einer – den Ausschluss von einer Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr rechtfertigenden – deutlichen Steigerung der dem öffentlichen Straßenverkehr innewohnenden Gefährlichkeit durch den Betroffenen höher liegt als bei einer Verkehrsteilnahme mit einem fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeug.
Dabei ist die aufgrund der Unterschiede der Fahrzeugarten – insbesondere hinsichtlich der erreichbaren Geschwindigkeit – im Vergleich zu fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen geringere Gefährlichkeit der fahrerlaubnisfreien Fahrzeuge für andere Verkehrsteilnehmer offenkundig und bedurfte deswegen keiner weiteren Aufklärung (vgl. bereits BVerfG, Beschluss vom 27. März 1979 – 2 BvL 7/78 –, BVerfGE 51, 60 = juris Rn. 56, wonach es sich von selbst verstehe und es deshalb keines ausdrücklichen gesetzlichen Hinweises bedürfe, dass der erreichbaren Geschwindigkeit die entscheidende Bedeutung für das Ausmaß der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zukomme; siehe allgemein dazu die Unfallstatistik des Statistischen Bundesamtes auf https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Verkehrsunfaelle/_inhalt.html#238554, zuletzt abgerufen am 20. März 2024, weder ergibt sich daraus allerdings die Unfallwahrscheinlichkeit im Verhältnis zum jeweiligen Verkehrsanteil hinreichend noch wird darin etwa zwischen einer Fremd- und Selbstschädigung des Unfallverursachers genügend differenziert; siehe zum jeweiligen Verkehrsanteil etwa den Kurzreport der für das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur durchgeführten Studie Mobilität in Deutschland 2017. Verkehrsaufkommen – Struktur – Trends, Ausgabe 2019, https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/mid-2017-kurzreport.pdf?__blob= publicationFile, S. 12 ff., zuletzt aufgerufen am 20. März 2024).
Auf eine abschließende Ermittlung des von den einzelnen Fahrzeugarten jeweils ausgehenden Risikos gerade für andere Verkehrsteilnehmer kommt es hier aber auch deswegen nicht entscheidend an, da jedenfalls nach den Wertungen des Gesetz- und Verordnungsgebers die von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen ausgehende Gefährlichkeit deutlich hinter dem von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen ausgehenden Risiko zurückbleibt (siehe bereits OVG RP, Urteil vom 17. August 2012 – 10 A 10284/12 –, juris Rn. 24; Beschluss vom 25. September 2009 – 10 B 10930/09 –, juris Rn. 8). Der Senat macht sich insoweit folgende Ausführungen des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs in seinem Urteil vom 17. April 2023 (11 BV 22.1234, juris Rn. 35 m.w.N.) zu eigen:
„Auch der Gesetz- und Verordnungsgeber hat rechtliche Differenzierungen für erforderlich gehalten. So hat er – abgesehen von den in § 4 Abs. 1 Satz 2 FeV vorgesehenen Ausnahmen – eine Fahrerlaubnispflicht nur für Kraftfahrzeuge sowie verschiedene Fahrerlaubnisklassen mit unterschiedlich hohen physischen und psychischen Anforderungen an die Fahrzeugführer sowie Nachweispflichten vorgesehen. Bei Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr kann nur das Führen eines Kraftfahrzeugs mit 0,25 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 0,5 ‰ oder mehr Alkohol im Blut oder unter der Wirkung eines in der Anlage zu § 24a StVG genannten berauschenden Mittels (Betäubungsmittels) mit Bußgeld geahndet werden. Im Strafrecht erfolgt eine Sanktionierung von Führern fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge, die keine Kraftfahrzeuge sind, nur, wenn die Voraussetzungen der Straftatbestände des § 315c oder des § 316 StGB erfüllt sind, für die das Führen jedes Fahrzeugs ausreicht, wobei die Rechtsprechung wegen des unterschiedlichen Gefährdungspotentials weiter beim Grenzwert für die absolute Fahrunsicherheit differenziert (bei Kraftfahrern ab einer BAK von 1,1 ‰, bei Fahrradfahrern ab 1,6 ‰; vgl. auch Pegel in MünchKomm zum StGB, § 316 Rn. 37, 40 f., 44 m.w.N.).“
Dabei wird gerade die Fahrerlaubnispflicht weiter noch dadurch verschärft, dass Fahren ohne Fahrerlaubnis nach § 21 StVG mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft wird, wohingegen derjenige, der entgegen § 3 Abs. 1 FeV vorsätzlich oder fahrlässig ein Fahrzeug führt oder einer vollziehbaren Anordnung oder Auflage zuwiderhandelt, „nur“ eine Ordnungswidrigkeit (§ 75 Nr. 3 FeV) begeht.
Beispielhaft für die unterschiedlich hohen physischen und psychischen Eignungsanforderungen, die der Gesetz- und Verordnungsgeber an Fahrzeugführer stellt, kann des Weiteren auf die abgestuften Altersgrenzen – die insbesondere von der für das Fahrzeug erlaubten Höchstgeschwindigkeit abhängen – verwiesen werden (vgl. zu diesem Aspekt auch Müller/Rebler, DAR 2023, 437 [441]). Dabei liegt das Mindestalter für den Erwerb einer Fahrerlaubnis der Klasse B grundsätzlich bei 18 Jahren (bzw. bei 17 Jahren für begleitetes Fahren), wohingegen Kraftfahrzeuge, für die eine Fahrerlaubnis nicht erforderlich ist, grundsätzlich bereits mit der Vollendung des 15. Lebensjahres in Deutschland geführt werden dürfen (vgl. § 10 FeV; siehe dazu etwa Ternig, in: Haus/Krumm/Quarch [Hrsg.], Gesamtes Verkehrsrecht, 3. Aufl. 2021, § 10 FeV Rn. 1; Dauer, in: Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 47. Aufl. 2023, § 10 FeV Rn. 18 f.). Noch weitergehend gibt es für Fahrzeuge, die keine Kraftfahrzeuge sind, – unbeschadet bestehender Aufsichtspflichten – grundsätzlich keine Mindestaltersgrenze, wobei Kinder ab 8 Jahren etwa bereits berechtigt – ab 10 Jahren sogar verpflichtet – sind, mit dem Fahrrad im öffentlichen Straßenverkehr die Fahrbahn zu nutzen, soweit kein Fahrradweg vorhanden ist; die Benutzung von Gehwegen mit Fahrrädern ist Kindern grundsätzlich nur bis 10 Jahren erlaubt (§ 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 Sätze 1 und 2 StVO; siehe dazu Schäfer, in: Dötsch et al. [Hrsg.], BeckOK StVR, Stand: 15. Januar 2024, § 2 StVO Rn. 104 ff.; König, in: Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 47. Aufl. 2023, § 2 StVO Rn. 29a).
Demgegenüber lässt sich ein mit dem Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge vergleichbares Gefahrenpotential durch fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge nach Überzeugung des Senats nicht allein daraus ableiten, dass fahruntüchtige Verkehrsteilnehmer erlaubnisfreier Fahrzeuge durch unvorhersehbare, insbesondere auf Mängeln der Fahrtauglichkeit beruhenden, Verhaltensweisen andere Verkehrsteilnehmer zu riskanten und folgenschweren Ausweichmanövern oder ähnlich gefährlichen Handlungen veranlassen könnten, wobei die Folgen eines auf diese Weise verursachten Unfalls genauso schwerwiegend sein könnten wie die Folgen eines von einem Kraftfahrzeugführer verursachten Verkehrsunfalls (so aber etwa OVG Nds, Beschluss vom 2. Februar 2012 – 12 ME 274/11 –, juris Rn. 7, 9; Beschluss vom 1. April 2008 – 12 ME 35/08 –, juris Rn. 7; HessVGH, Urteil vom 6. Oktober 2010 – 2 B 1076/10 –, juris Rn. 12; ThürOVG, Beschluss vom 9. Mai 2012 – 2 SO 596/11 –, juris Rn. 8; VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 16. November 2023 – 7 L 1617/23 –, juris Rn. 56; siehe auch OVG RP, Urteil vom 17. August 2012 – 10 A 10284/12 –, juris Rn. 27; HessVGH, Urteil vom 6. Oktober 2010 – 2 B 1076/10 –, juris Rn. 12). Ein solches Risiko mag zwar grundsätzlich bestehen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass ein derart geschildertes – mittelbares – Risiko, einen anderen Verkehrsteilnehmer zu riskanten und folgenschweren Ausweichmanövern oder ähnlich gefährlichen Handlungen zu veranlassen, auch von einem fahruntüchtigen Führer eines fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugs ausgehen kann, weshalb in einer Gesamtbetrachtung das vom Führer eines fahrerlaubnisfreien Fahrzeugs ausgehende Gefährdungspotential gleichwohl deutlich hinter dem vom Führer eines fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugs ausgehenden Risiko zurück bleibt. Vor dem Hintergrund, dass von einer Untersagungsverfügung Betroffene weiterhin als Fußgänger oder auf besonderen Fortbewegungsmitteln i.S.d. § 24 Abs. 1 StVO – wie etwa Roller oder Inline-Skates –, die nicht als Fahrzeuge i.S.d. Fahrerlaubnisverordnung gelten, am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen dürfen und deshalb das von ihnen ausgehende Risiko, in der geschilderten (mittelbaren) Weise einen schweren Unfall zu verursachen, weiterhin fortbesteht, und unter Berücksichtigung des Umstands, dass bereits achtjährige Kinder mit Fahrrädern die Fahrbahn benutzen dürfen (vgl. § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 5 Sätze 1 und 2 StVO), ist im Übrigen auch zweifelhaft, ob die Untersagung des Führens fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge überhaupt zentral auf solche mittelbaren Gefahrenpotentiale abzielt.
Schließlich trifft es zwar zu, dass auch von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen – wobei insoweit möglicherweise zwischen den unterschiedlichen Fahrzeugarten eine Binnendifferenzierung vorzunehmen sein dürfte – ein nicht zu unterschätzendes Gefährdungspotential für andere Verkehrsteilnehmer – wohl insbesondere für Fußgänger und ggf. andere Radfahrer – ausgeht (vgl. etwa BVerwG, Beschluss vom 20. Juni 2013 – 3 B 102.12 –, juris Rn. 7; OVG Nds, Beschluss vom 23. August 2023 – 12 ME 93/23 –, juris Rn. 10; Beschluss vom 2. Februar 2012 – 12 ME 274/11 –, juris Rn. 7; OVG RP, Urteil vom 17. August 2012 – 10 A 10284/12 –, juris Rn. 27; Borgmann, NZV 2023, 300 [306 Rn. 37 ff.]; siehe auch Statistisches Bundesamt, Fehlverhalten der Radfahrer/innen bei Unfällen mit Personenschaden, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Verkehrsunfaelle/ Tabellen/fehlverhalten-radfahrer.html, zuletzt abgerufen am 20. März 2024, woraus sich allerdings nicht ergibt, inwieweit bei durch Radfahrer verursachten Unfällen Dritte oder der Radfahrer geschädigt werden; GDV Unfallforschung der Versicherer, Innerörtliche Unfälle zwischen zu Fuß Gehenden und Radfahrenden, 2023, https://www.udv.de/resource/blob/159608/8dd9f221a6780721b5d0613deec91cca/93-fuss-rad-unfaelle-data.pdf, zuletzt aufgerufen am 20. März 2024), das bei fehlender Eignung eine Untersagung des Führens solcher Fahrzeuge im Straßenverkehr rechtfertigt. Dieses Risiko bleibt aber – bei gleichzeitig hoher Eingriffsintensität – nach Vorstehendem hinter dem von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen ausgehenden Risiko zurück, weshalb es nach den eingangs dargestellten Maßstäben nicht gerechtfertigt ist, die für das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge geltenden strengen Eignungsanforderungen in Gänze und mit der in § 3 Abs. 1 Satz 1 FeV im Falle der Ungeeignetheit vorgesehenen Rechtsfolge eines zwingenden behördlichen Einschreitens gegen den Betroffenen (vgl. etwa Dauer, in: Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 47. Aufl. 2023, § 3 FeV Rn. 16; OVG Nds, Beschluss vom 2. Februar 2012 – 12 ME 274/11 –, juris Rn. 9; ThürOVG, Beschluss vom 9. Mai 2012 – 2 SO 596/11 –, juris Rn. 6) ohne Differenzierungen auf das Führen fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge anzuwenden (siehe auch Borgmann, NZV 2023, 300 [307 Rn. 43 ff.]). Bei einer pauschalen Übertragung sämtlicher Eignungsanforderungen würde § 3 FeV zumindest auch zu unverhältnismäßigen Eingriffen ermächtigen und damit – ungeachtet der hier konkret zu beurteilenden Untersagungsverfügung – gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoßen (vgl. BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 41).
(4) Schließlich dürfte – ohne dass es darauf noch entscheidend ankommt – bei einer solchen Auslegung auch ein Verstoß der Vorschrift gegen den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) in Gestalt der Gleichbehandlung von wesentlich Ungleichem gegeben sein, wenn identische physische und psychische Anforderungen an das Führen von fahrerlaubnispflichtigen und -freien Fahrzeugen gestellt werden.
Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gebietet dem Gesetzgeber, wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln (vgl. BVerfG, Beschluss vom 19. November 2019 – 2 BvL 22/14 –, BVerfGE 152, 274 = juris Rn. 95; Beschluss vom 28. November 2023 – 2 BvL 8/13 –, juris Rn. 139; stRspr; Wollenschläger, in: von Mangoldt/Klein/Starck [Hrsg.], Grundgesetz, 7. Aufl. 2018, Art. 3 Rn. 169 ff.). Insoweit ist der Gesetzgeber aber nicht verpflichtet, unter allen Umständen Ungleiches ungleich zu behandeln. Der allgemeine Gleichheitssatz ist auch nicht schon dann verletzt, wenn der Gesetzgeber Differenzierungen, die er vornehmen darf, nicht vornimmt. Entscheidend ist vielmehr, ob für eine am Gerechtigkeitsgedanken orientierte Betrachtungsweise die tatsächlichen Ungleichheiten in dem jeweils in Betracht kommenden Zusammenhang so bedeutsam sind, dass der Gesetzgeber sie bei seiner Regelung beachten muss (vgl. BVerfG, Beschluss vom 12. Mai 1992 – 1 BvR 1467/91 –, BVerfGE 86, 81 = juris Rn. 23; Beschluss vom 15. Juli 1998 – 1 BvR 1554/89 –, BVerfGE 98, 365 = juris Rn. 63; Beschluss vom 23. Mai 2006 – 1 BvR 1484/99 –, BVerfGE 115, 381 = juris Rn. 23). Art. 3 Abs. 1 GG ist danach jedenfalls dann verletzt, wenn für die gleiche Behandlung verschiedener Sachverhalte – bezogen auf den in Rede stehenden Sachbereich und seine Eigenart – ein vernünftiger, einleuchtender Grund fehlt (vgl. BVerfG, Beschluss vom 23. März 1994 – 1 BvL 8/85 –, BVerfGE 90, 226 = juris Rn. 54; Beschluss vom 23. Mai 2006 – 1 BvR 1484/99 –, BVerfGE 115, 381 = juris Rn. 23; siehe allgemein BVerfG, Beschluss vom 28. November 2023 – 2 BvL 8/13 –, juris Rn. 141 m.w.N.; stRspr).
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der allgemeine Gleichheitssatz umso strengere Beachtung verlangt, je stärker sich die Ungleichbehandlung von Personen oder Sachverhalten auf die Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten nachteilig auswirken kann (vgl. BVerfG, Urteil vom 9. Dezember 2008 – 2 BvL 1/07 –, BVerfGE 122, 210 = juris Rn. 56; Beschluss vom 28. November 2023 – 2 BvL 8/13 –, juris Rn. 142; Beschluss vom 24. Juni 1993 – 1 BvR 689/92 –, BVerfGE 89, 69 = juris Rn. 73; stRspr). Der unterschiedlichen Tragweite des Grundrechts entspricht eine abgestufte Kontrolldichte bei der verfassungsgerichtlichen Prüfung (vgl. BVerfG, Beschluss vom 24. Juni 1993 – 1 BvR 689/92 –, BVerfGE 89, 69 = juris Rn. 73).
Daran gemessen dürfte die Anwendung identischer physischer und psychischer Anforderungen auf das Führen von (fahrerlaubnispflichtigen) Kraftfahrzeugen und von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen gegen den allgemeinen Gleichheitssatz verstoßen. Wie sich bereits aus den Ausführungen unter II. 2. b) cc) (3) ergibt, sind bei einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise die tatsächlichen Ungleichheiten zwischen dem Führen von fahrerlaubnisfreien und fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen derart bedeutsam, dass der Gesetz- und Verordnungsgeber sie bei seiner Regelung beachten muss. Gerade dies hat ihn – wie gezeigt – an verschiedenen Stellen zu differenzierenden Regelungen bewogen. Dabei hat – wie ebenfalls bereits dargestellt – die Untersagung des Führens fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge erheblichen Einfluss auf die Ausübung von grundrechtlich geschützten Freiheiten. Das gilt nicht nur für die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG), sondern darüber hinaus je nach Lage der Dinge auch für spezielle Freiheitsrechte wie etwa die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG). Deshalb sind an die Gründe, die eine Gleichbehandlung wesentlich ungleicher Sachverhalte hier rechtfertigen können, strenge Maßstäbe anzulegen (siehe in anderem Zusammenhang auch BVerfG, Beschluss vom 24. Juni 1993 – 1 BvR 689/92 –, BVerfGE 89, 69 = juris Rn. 74). Hinreichende Gründe, die eine Gleichbehandlung von derart Ungleichem rechtfertigen könnten, sind indes nicht ohne weiteres ersichtlich.
dd) Die gebotene Konkretisierung der Eignungsanforderungen des § 3 Abs. 1 Satz 1 FeV lässt sich weiter nicht über eine restriktive – zugleich die Grenzen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes wahrende – Auslegung erreichen, bei der über § 3 Abs. 2 FeV die §§ 11 bis 14 FeV nur „entsprechend“ angewendet werden, soweit die in Bezug genommenen Regelungen ihrem Inhalt nach nicht das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge voraussetzen (siehe zu dieser Auslegung BVerwG, Beschluss vom 20. Juni 2013 – 3 B 102.12 –, juris Rn. 6 f.; OVG RP, Beschluss vom 8. Juni 2011 – 10 B 10415/11 –, juris Rn. 6; OVG Nds, Beschluss vom 23. August 2023 – 12 ME 93/23 –, juris Rn. 9 f.; VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 16. November 2023 – 7 L 1617/23 –, juris Rn. 14 ff., 54 ff. 84; Dauer, in: Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 47. Aufl. 2023, § 3 FeV Rn. 11; Müller/Rebler, DAR 2023, 437 [439]; Begemann, in: Freymann/Wellner [Hrsg.], jurisPK-Straßenverkehrsrecht, 2. Aufl. 2022, § 3 FeV Rn. 19 f.).
Denn je nach Verständnis führt auch eine solche (restriktive) Auslegung entweder wiederum zu einer zu weitgehenden Übertragung der für das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge geltenden Anforderungen auf das Führen von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen oder diese bietet – bei konsequenter Anwendung – nur in einem derart begrenzten Umfang Kriterien für die Beurteilung der Eignung zum Führen fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge, dass es in einer Gesamtbetrachtung weiterhin an einer hinreichenden Bestimmtheit des § 3 Abs. 1 Satz 1 FeV mangelt.
So sind – wie bereits unter II. 2. b) aa) festgestellt – die §§ 11 bis 14 FeV einschließlich der hierzu ergangenen Anlagen zwar auf die Eignung zum Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen zugeschnitten. Dabei knüpfen die meisten der genannten Vorschriften aber nicht an ein bestimmtes Verhalten – ob als Führer eines Kraftfahrzeugs oder eines sonstigen Fahrzeugs – im Straßenverkehr an, sondern sie regeln meist unabhängig hiervon die für das Führen eines Kraftfahrzeugs notwendigen körperlichen und geistigen Anforderungen bzw. das Vorliegen diesbezüglicher Eignungszweifel. Dies gilt etwa für § 12 FeV i.V.m. Anlage 6 zu den §§ 12, 48 Absatz 4 und 5 FeV hinsichtlich der Anforderungen an das Sehvermögen, § 13 Satz 1 Nr. 1 FeV hinsichtlich einer Alkoholabhängigkeit, § 14 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 FeV hinsichtlich der Abhängigkeit oder Einnahme von Betäubungsmitteln im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes. Auch die meisten der in Anlage 4 zu den §§ 11, 13 und 14 FeV aufgeführten Krankheiten und Mängel, die die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen längere Zeit beeinträchtigen oder aufheben können, knüpfen nicht unmittelbar an das Führen eines (Kraft-)Fahrzeugs an (vgl. Ziff. 1 bis 7, 8.3, 9.1., 9.2.1, 9.3 bis 11.4 Anlage 4 zu den §§ 11, 13 und 14 FeV). Etwas anderes gilt – abgesehen von der Fallgruppe erheblicher oder wiederholter Verstöße gegen verkehrsrechtliche Vorschriften oder Strafgesetze (vgl. § 11 Abs. 1 Satz 3 FeV) – letztlich nur im Zusammenhang mit Alkoholkonsum, bei dem keine Abhängigkeit vorliegt bzw. vermutet wird (vgl. Ziff. 8.1 Anlage 4 zu den §§ 11, 13 und 14 FeV, § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a) FeV, § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b) FeV, § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c) FeV) und der (nur) gelegentlichen Einnahme von Cannabis (vgl. Ziff. 9.2.2 zu den §§ 11, 13 und 14 FeV, § 14 Abs. 1 Satz 3 FeV, siehe aber außerdem noch § 14 Abs. 2 Nr. 3 FeV). Während § 14 Abs. 2 Nr. 3 FeV dabei über § 24a StVG das Führen eines Kraftfahrzeugs voraussetzt, fehlt insbesondere die Eignung aufgrund Alkoholmissbrauchs schon dann, wenn das Führen von Fahrzeugen – also nicht nur von Kraftfahrzeugen – und ein die Fahrsicherheit beeinträchtigender Alkoholkonsum nicht hinreichend sicher getrennt werden kann (Ziff. 8.1 Anlage 4 zu den §§ 11, 13 und 14 FeV); ein medizinisch-psychologisches Gutachten ist u.a. dann beizubringen, wenn ein Fahrzeug – wiederum ohne Differenzierung nach Fahrzeugarten und daher nicht begrenzt auf Kraftfahrzeuge (vgl. BVerwG, Beschluss vom 20. Juni 2013 – 3 B 102.12 –, juris Rn. 7) – im Straßenverkehr bei einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 ‰ oder mehr oder einer Atemalkoholkonzentration von 0,8 mg/l oder mehr geführt wurde (vgl. § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c) FeV).
Würden nun bei diesem Befund sämtliche Vorschriften der §§ 11 bis 14 FeV einschließlich der hierzu ergangenen Anlagen auf die Untersagung des Führens fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge entsprechend angewendet, die zwar die Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs regeln, die dabei aber nicht – wie etwa § 14 Abs. 2 Nr. 3 FeV – ausdrücklich an das Führen eines Kraftfahrzeugs anknüpfen, führte dies zu einer Übertragung nahezu aller Eignungsanforderungen. Die vorgenommene Beschränkung des Anwendungsbereichs wäre derart gering, dass gemessen an den Darlegungen unter II. 2. b) cc) (3) hierdurch eine verhältnismäßige – und damit verfassungskonforme – Auslegung des § 3 Abs. 1 Satz 1 FeV nicht erreicht würde.
Würden aber umgekehrt nur diejenigen Vorschriften der §§ 11 bis 14 FeV einschließlich der hierzu ergangenen Anlagen auf die Untersagung des Führens fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge entsprechend angewendet, die zwar nach ihrem Wortlaut nur die Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs regeln, die dabei aber ausdrücklich an das Führen eines Fahrzeugs – und eben nicht nur eines Kraftfahrzeugs – anknüpfen, würde der Anwendungsbereich zwar substantiell beschränkt, dies aber in einem derart großen Umfang, dass es dem § 3 FeV weiterhin an der hinreichenden Bestimmtheit mangelte. Abgesehen von den wenigen aufgeführten Ausnahmen – insbesondere § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c FeV, für den höchstrichterlich ausdrücklich entschieden ist, dass dieser über § 3 Abs. 2 FeV auch etwa auf Fahrradfahrer anwendbar ist und die Anordnung, ein medizinisch-psychologisches Gutachten über die Eignung zum Führen fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge beizubringen, rechtfertigt (vgl. BVerwG, Beschluss vom 20. Juni 2013 – 3 B 102.12 –, juris Rn. 6 f. m.w.N.), sowie Ziffer 8.1 der Anlage 4 zu den §§ 11, 13 und 14 FeV (vgl. OVG Nds, Beschluss vom 23. August 2023 – 12 ME 93/23 –, juris Rn. 9) – ließen sich den Vorschriften keine hinreichenden Anhaltspunkte entnehmen, welche Erkrankungen und Mängel die Eignung zum Führen eines Fahrzeugs, das kein Kraftfahrzeug ist, im Einzelfall ausschließen und unter welchen konkreten Voraussetzungen die in den §§ 11 bis 14 FeV vorgesehenen Gefahrerforschungsmaßnahmen getroffen werden dürfen (vgl. BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 36).
Unklar bliebe danach weiterhin etwa auch, was nach einer ebenso wie eine Trunkenheitsfahrt unter Strafe gestellten Fahrt im Zustand der durch andere berauschende Mittel herbeigeführten Fahruntüchtigkeit (§ 316 StGB) gelten soll, sowie ob § 14 FeV entsprechend anwendbar ist, wenn der Betroffene durch die Betäubungsmitteleinnahme keine Verkehrszuwiderhandlung begangen hat, insbesondere bei Konsum anderer Betäubungsmittel als Cannabis, der die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen ausschließt, ohne dass es der Einholung eines Gutachtens bedarf (vgl. § 11 Abs. 7 FeV und Nr. 9.1 der Anlage 4 zur FeV; vgl. dazu BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 36).
In einer Vielzahl von Fallgestaltungen bliebe demnach auch bei einer Auslegung, die über § 3 Abs. 2 FeV die §§ 11 bis 14 FeV einschließlich der hierzu ergangenen Anlagen nur insoweit entsprechend anwendet, als die in Bezug genommenen Regelungen ihrem Inhalt nach nicht das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge voraussetzen (siehe auch BVerwG, Beschluss vom 20. Juni 2013 – 3 B 102.12 –, juris Rn. 6), der Verwaltung letztlich – ohne hinreichende normative Vorgaben – die Entscheidung darüber überlassen, ob und inwieweit die für das Führen von Kraftfahrzeugen geltenden Eignungsanforderungen im Einzelfall auf das Führen fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge – insbesondere solcher, die keine Kraftfahrzeuge sind – entsprechend angewendet werden können, ohne den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu verletzen. Auf diese Weise bliebe es – was das Bestimmtheitsgebot verletzt – aufgrund einer Inbezugnahme von Vorschriften, die eine andersartige Spannungslage bewältigen, der Verwaltung überlassen, die Voraussetzungen und Grenzen des Grundrechtseingriffs letztlich selbst zu bestimmen (vgl. BVerfG, Urteil vom 24. Juli 2018 – 2 BvR 309/15 –, BVerfGE 149, 293 = juris Rn. 78 m.w.N.; BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 31 m.w.N.; BVerwG, Beschluss vom 31. Mai 2022 – 6 C 2.20 –, juris Rn. 47; vgl. zu den Grenzen einer verfassungskonformen Auslegung bei nicht hinreichend bestimmten Normen auch BVerfG, Urteil vom 16. Januar 2003 – 2 BvR 716/01 –, BVerfGE 107, 104 = juris Rn. 96 f.).
Aufgrund des für die Beurteilung der Eignungsfrage in der Regel erforderlichen medizinisch/psychologischen Sachverstands kann schließlich auch – von Ausnahmen abgesehen – nicht davon ausgegangen werden, dass deren Vornahme der Verwaltung unter Wahrung insbesondere der durch den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gesetzten Grenzen ohne hinreichend bestimmte normative Vorgaben allein auf der Grundlage allgemeiner Lebenserfahrung möglich ist (vgl. BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 39; siehe zu der Abgrenzungsproblematik auch Geiger, SVR 2007, 161 [162]; siehe demgegenüber OVG Nds, Beschluss vom 23. August 2023 – 12 ME 93/23 –, juris Rn. 10). Insbesondere in den Fällen, in denen die Behörde nicht bloß Eignungszweifel hat, sondern sie die Ungeeignetheit nach Maßgabe des § 11 FeV, Anlage 4 zu den §§ 11, 13 und 14 FeV bereits ohne vorherige weitere Erforschungsmaßnahmen als erwiesen betrachtet, stehen ihr auch keine auf den Einzelfall bezogenen medizinisch/psychologischen Erkenntnisse auf der Grundlage eines Sachverständigengutachtens zur Verfügung (vgl. demgegenüber VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 16. November 2023 – 7 L 1617/23 –, juris Rn. 84). Unbeschadet dessen wird durch den Verweis auf die Möglichkeit der Heranziehung derartiger Erkenntnisse verkannt, dass bereits die Anordnung eines entsprechenden Gutachtens selbst einen erheblichen und rechtfertigungsbedürftigen Grundrechtseingriff darstellt (siehe zum tiefgreifenden Eingriff in das durch Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG geschützte allgemeine Persönlichkeitsrecht durch eine – hier nicht streitgegenständliche – Aufforderung zur Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens: BVerfG, Beschluss vom 24. Juni 1993 – 1 BvR 689/92 –, BVerfGE 89, 69 = juris Rn. 51 ff. 67; OVG RP, Urteil vom 17. August 2012 – 10 A 10284/12 –, juris Rn. 24; Beschluss vom 25. September 2009 – 10 B 10930/09 –, juris Rn. 9).
ee) Weiter lässt sich eine zuverlässige Grundlage für die Auslegung und Anwendung des § 3 Abs. 1 Satz 1 FeV hinsichtlich der Untersagung des Führens fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge nicht aufgrund einer gefestigten Rechtsprechung gewinnen. Der Senat verweist insoweit auf die Ausführungen des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs in seinem Urteil vom 17. April 2023 (11 BV 22.1234, juris Rn. 38), die er sich zu eigen macht:
„Rechtsprechung liegt fast ausschließlich zu Trunkenheitsfahrten, kaum zu Fahrten unter Drogeneinfluss vor (vgl. BayVGH, B.v. 23.3.2023 – 11 CS 23.59 – ZfSch 2023, 294: keine Eignungszweifel hinsichtlich Fahrradfahrens bei Fahrt mit E-Scooter unter der Wirkung von Cannabis [§ 24a Abs. 2, Abs. 3 StVG]; zu Eignungszweifeln hinsichtlich aller Fahrzeuge bei Fahrradfahrt mit BAK ab 1,6 ‰ siehe: BVerwG, B.v. 20.6.2013 – 3 B 102.12 – a.a.O.: BAK von 1,9 ‰; BayVGH, B.v. 9.8.2016 – 11 ZB 16.880 – ZfSch 2016, 655: BAK von 1,85 ‰ und Kfz-Fahrt mit BAK ab 1,15 ‰; B.v. 8.4.2016 – 11 C 16.319 u.a. – juris: BAK von 2,06 ‰, 2,02 ‰ und 2,30 ‰; B.v. 2.9.2016 – 11 ZB 16.1359 – juris: BAK von 2,19 ‰ und Kfz-Fahrt mit BAK von 2,4 ‰; B.v. 22.12.2014 – 11 ZB 14.1516 – juris: BAK von 1,96 ‰; B.v. 15.5.2013 – 11 ZB 13.450 u.a. – juris: BAK von 2,12 ‰; B.v. 8.2.2010 – 11 C 09.2200 – DAR 2010, 483: BAK von 1,7 ‰; SächsOVG, B.v. 19.8.2022 – 6 B 170/22 – Blutalkohol 59, 618: BAK von 2,57 ‰; OVG RP, U.v. 17.8.2012 – 10 A 10284/12 – DAR 2012, 601 = juris Rn. 23, 31: BAK von 2,44 ‰; VGH BW, B.v. 24.1.2012 – 10 S 3175/11 – DAR 2012, 164: BAK von 2,49 ‰; ThürOVG, B.v. 9.5.2012 – 2 SO 596/11 – DAR 2012, 721: BAK von 1,7 ‰; OVG Berlin-Brandenbg., B.v. 28.2.2011 – OVG 1 S 19.11 u.a. – juris: BAK von 2,57 ‰; HessVGH, B.v. 6.10.2010 – 2 B 1076/10 – Blutalkohol 47, 436: BAK von 1,75 ‰; OVG Saarland, B.v. 3.5.2021 – 1 B 30/21 – ZfSch 2021, 659: Eignungszweifel hinsichtlich erlaubnisfreier Fahrzeuge bei Mofafahrt mit BAK von 1,83 ‰; VG Gelsenkirchen, B.v. 23.7.2021 – 7 L 901/21 – juris Rn. 89 ff.: Ermessensreduzierung auf null bei Alkoholabhängigkeit hinsichtlich der Untersagung des Fahrradfahrens; OVG Hamburg, B.v. 20.6.2005 – 3 Bs 72/05 – Blutalkohol 44,56: Eignungszweifel hinsichtlich erlaubnisfreiem Kfz [Mofa] wegen gelegentlichen Cannabiskonsums; VG Koblenz, B.v. 31.8.2022 – 4 L 810/22.KO – ZfSch 2023, 58: keine Eignungszweifel bezogen auf fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge bei übermäßigem Alkoholkonsum ohne Verkehrsbezug; OVG RP, B.v. 8.6.2011 – 10 B 10451/11 – NJW 2011, 3801 = juris Rn. 8: keine Eignungszweifel bezogen auf fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge bei Trunkenheitsfahrt mit einem Kfz mit BAK von 1,1 ‰). Hiernach rechtfertigt eine Trunkenheitsfahrt mit einem Fahrrad bei einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 ‰ oder mehr oder einer Atemalkoholkonzentration von 0,8 mg/l oder mehr aufgrund der ausdrücklich für alle Fahrzeuge geltenden Regelung des § 13 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c FeV Eignungszweifel auch hinsichtlich des Führens fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge und daher die Anordnung, ein medizinisch-psychologisches Gutachten beizubringen. Nicht entschieden ist hingegen, ob dies auch für eine entsprechende Trunkenheitsfahrt mit einem Kraftfahrzeug hinsichtlich fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge gilt (Dauer in Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, § 3 FeV Rn. 15). Dagegen könnte sprechen, dass § 69 StGB die vom Strafgericht auszusprechenden präventiven Maßnahmen bei einer solchen Straftat auf die Entziehung der Fahrerlaubnis wegen Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen begrenzt und keine Maßnahmen für fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge vorsieht. Ungeklärt ist ferner, ob in den übrigen Fällen des § 13 Satz 1 FeV Eignungszweifel hinsichtlich sonstiger Fahrzeuge und entsprechende Gefahrenerforschungsmaßnahmen gerechtfertigt sind. Erst recht ergeben sich aus den Entscheidungen keine handhabbaren Maßstäbe bezogen auf den Drogenkonsum. Entscheidungen zu Eignungsmängeln aufgrund pathologischer Zustände oder charakterlicher Mängel sind nicht ersichtlich. Dabei kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Fehlen gerichtlicher Entscheidungen in weiten Teilen des potentiellen Anwendungsbereichs des § 3 FeV allein auf eine am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz orientierte Zurückhaltung bei der Anwendung dieser Vorschrift hinweist.“
ff) Der Verwaltung stehen auch anderweitige (objektivierbare) Maßstäbe – in tatsächlicher/medizinischer/psychologischer Hinsicht – nicht zur Verfügung, anhand derer sie die Eignung eines Betroffenen zum Führen fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge beurteilen könnte. Denn für das Führen fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge existieren keine den Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung (vom 27. Januar 2014 [VkBl. S. 110] in der Fassung vom 17. Februar 2021 [VkBl. S. 198]) vergleichbaren antizipierten Sachverständigengutachten, die insoweit den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis wiedergeben (vgl. BVerwG, Urteil vom 14. November 2013 – 3 C 32.12 –, BVerwGE 148, 230 = juris Rn. 19), oder entsprechend entwickelte Beurteilungskriterien der Deutschen Gesellschaften für Verkehrspsychologie und Verkehrsmedizin, aus denen sich die in Ziffer 1 Buchst. c der Anlage 4a zu § 11 Abs. 5 FeV der Fahreignungsbegutachtung zugrunde zu legenden anerkannten wissenschaftlichen Grundsätze ergeben (BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 37; Rebler/Müller, DAR 2014, 690 [694]). Aufgrund des für die Beurteilung der Eignungsfrage in der Regel erforderlichen medizinisch/ psychologischen Sachverstands kann – wie bereits dargestellt – schließlich auch – von Ausnahmen abgesehen – nicht davon ausgegangen werden, dass deren Vornahme der Verwaltung unter Wahrung insbesondere der durch den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gesetzten Grenzen ohne hinreichend bestimmte normative Vorgaben allein auf der Grundlage allgemeiner Lebenserfahrung möglich ist (vgl. BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 39; siehe aber OVG Nds, Beschluss vom 23. August 2023 – 12 ME 93/23 –, juris Rn. 10). Es kann – wie ebenfalls bereits ausgeführt – auch nicht darauf verwiesen werden, dass sich die Fahrerlaubnisbehörde die erforderlichen Erkenntnisse durch die Einholung von Sachverständigengutachten verschaffen könne. Zum einen fehlt es auch für die Erstellung solcher Gutachten an den erforderlichen verallgemeinerungsfähigen Vorgaben und zum anderen handelt es sich bereits bei der Anordnung eines entsprechenden Gutachtens um einen erheblichen und rechtfertigungsbedürftigen Grundrechtseingriff (siehe zum Eingriff in das durch Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG geschützte allgemeine Persönlichkeitsrecht durch eine – hier nicht streitgegenständliche – Aufforderung zur Beibringung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens: BVerfG, Beschluss vom 24. Juni 1993 – 1 BvR 689/92 –, BVerfGE 89, 69 = juris Rn. 51 ff. 67; OVG RP, Urteil vom 17. August 2012 – 10 A 10284/12 –, juris Rn. 24; Beschluss vom 25. September 2009 – 10 B 10930/09 –, juris Rn. 9).
III. § 3 Abs. 1 Satz 1 FeV ist als Rechtsgrundlage für die streitgegenständliche Untersagung des Führens von fahrerlaubnisfreien Kraftfahrzeugen unwirksam; die festgestellten Verstöße gegen den Verhältnismäßigkeits- bzw. Bestimmtheitsgrundsatz führen von Verfassungs wegen zur Unwirksamkeit des § 3 Abs. 1 Satz 1 FeV (vgl. BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 20; siehe allgemein zur Rechtsfolge der Unwirksamkeit einer Verordnungsnorm bei mangelnder Bestimmtheit BVerwG, Urteil vom 26. März 2015 – 7 C 17.12 –, BVerwGE 152, 1 = juris Rn. 34; zur Unwirksamkeit einer Verordnung bei deren Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz BVerwG, Urteil vom 21. Juni 2023 – 3 CN 1/22 –, juris Rn. 53). Bei Rechtssätzen führt eine teilweise Nichtigkeit dann nicht zur umfassenden Unwirksamkeit, wenn die Regelung ohne den nichtigen Teil sinnvoll bleibt und mit Sicherheit angenommen werden kann, dass sie auch ohne diesen erlassen worden wäre (BVerwG, Urteil vom 26. März 2015 – 7 C 17.12 –, BVerwGE 152, 1 = juris Rn. 34; Urteil vom 16. Mai 2023 – 3 CN 6/22 –, juris Rn. 81). Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. Da die mangelnde Bestimmtheit mit der Ungeeignetheit zum Führen von (fahrerlaubnisfreien) Fahrzeugen gerade das zentrale Tatbestandsmerkmal des § 3 Abs. 1 Satz 1 FeV betrifft, ist diese Vorschrift insgesamt – und nicht nur bezogen auf einzelne Eignungsmängel – unwirksam (siehe auch BayVGH, Beschluss vom 25. Juli 2023 – 11 CS 23.125 –, juris Rn. 34); die übrigen Vorschriften der Fahrerlaubnisverordnung werden hiervon indes nicht berührt.
Mangels wirksamer Rechtsgrundlage ist die mit Bescheid vom 8. Februar 2023 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 15. Mai 2023 verfügte Untersagung, fahrerlaubnisfreie Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr zu führen, rechtswidrig. Infolge der deshalb rechtswidrigen Untersagung erweist sich auch die in vorgenannten Bescheiden angeordnete Aufforderung zur Abgabe der Mofaprüfbescheinigung (vgl. § 3 Abs. 1 Satz 2 FeV) als rechtswidrig.
Auf die Frage, ob die gesetzliche Verordnungsermächtigung des § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. y StVG a.F. den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt, kommt es aufgrund der festgestellten Unwirksamkeit des § 3 Abs. 1 Satz 1 FeV nicht mehr entscheidungserheblich an (vgl. hierzu BVerwG, Urteil vom 4. Dezember 2020 – 3 C 5.20 –, BVerwGE 171, 1 = juris Rn. 34-37; BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 21; zweifelnd auch Müller/Rebler, DAR 2023, 437 [441]; Borgmann, NZV 2023, 300 [305 Rn. 31 ff.]; demgegenüber: OVG Nds, Beschluss vom 1. April 2008 – 12 ME 35/08 –, juris Rn. 6; OVG NRW, Beschluss vom 23. April 2015 – 16 B 259/15 –, juris Rn. 4-6; VG Gelsenkirchen, Beschluss vom 16. November 2023 – 7 L 1617/23 –, juris Rn. 29 ff.).
IV. Schließlich kommt in vorliegendem Zusammenhang die gerichtliche Anordnung einer vorübergehenden weiteren Anwendung des § 3 Abs. 1 Satz 1 FeV als Rechtsgrundlage für die Untersagung des Führens fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge ebenso wenig in Betracht wie eine verwaltungsgerichtlich zu treffende Übergangsregelung (so i.E. wohl auch BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris; Beschluss vom 25. Juli 2023 – 11 CS 23.125 –, juris; vgl. demgegenüber OVG Nds, Beschluss vom 23. August 2023 – 12 ME 93/23 –, juris Rn. 11, dort offen gelassen für Personen, die als Radfahrer durch Trunkenheitsfahrten [§ 316 StGB] andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährden).
Im Ausgangspunkt ist es den Verwaltungsgerichten – anders als dem Bundesverfassungsgericht oder etwa dem Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz, die zum Erlass derartiger Anordnungen über die Art und Weise der Vollstreckung ihrer Entscheidungen befugt sind (vgl. § 35 Bundesverfassungsgerichtsgesetz – BVerfGG – bzw. § 31 Abs. 2 und § 79 Abs. 1 BVerfGG bzw. § 20 Abs. 3 des Landesgesetzes über den Verfassungsgerichtshof – Verfassungsgerichtshofgesetz, VerfGHG –; siehe dazu OVG RP, Beschluss vom 27. Mai 2022 – 10 A 11418/21.OVG –, juris Rn. 12; Urteil vom 12. Juli 2023 – 10 A 10425/19 –) – bei Anfechtungsklagen (ebenso wie im Normenkontrollverfahren, vgl. BVerwG, Urteil vom 9. Juni 2010 – 9 CN 1.09 –, BVerwGE 137, 123 = juris Rn. 29) nämlich grundsätzlich verwehrt, von der inzidenten Feststellung der Unwirksamkeit einer Rechtsnorm oder von der daraus resultierenden Aufhebung der auf ihr beruhenden Verwaltungsakte wegen der damit verbundenen Folgen abzusehen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 10. Februar 2000 – 11 B 54.99 –, juris Rn. 7; Beschluss vom 26. Januar 1995 – 8 B 193.94 –, juris Rn. 8 f.; OVG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 26. November 2002 – 2 M 96/02 –, juris Rn. 9; HessVGH, Beschluss vom 6. Oktober 2010 – 5 A 2593/09.Z –, juris Rn. 6, jeweils zu Satzungen). Denn die Verwaltungsgerichtsordnung bietet hierfür – insbesondere in § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO – keinen gesetzlichen Anknüpfungspunkt.
Vorliegend ist auch nicht in Abkehr von diesem Grundsatz eine – wohl nur in engen Grenzen denkbare – Ausnahme zuzulassen, um einen der verfassungsmäßigen Ordnung noch ferneren Zustand zu vermeiden (vgl. dazu etwa BVerwG, Urteil vom 10. April 2019 – 6 C 19.18 –, BVerwGE 165, 202 = juris Rn. 20; Urteil vom 28. Oktober 2020 – 6 C 8.19 –, BVerwGE 170, 1 = juris Rn. 24, jeweils zum Prüfungsrecht, wenn es an einer hinreichenden rechtssatzmäßigen Festsetzung des Prüfungsverfahrens fehlt und zur Vermeidung einer verfassungsferneren Regelungslücke und zur Wahrung der Berufsfreiheit bis zur notwendigen rechtssatzmäßigen Schließung der Regelungslücke eine verwaltungsgerichtlich getroffene Übergangsregelung unerlässlich ist; BVerwG, Urteil vom 7. Juli 2021 – 2 C 2.21 –, BVerwGE 173, 81 = juris Rn. 40 zum Beurteilungsrecht, wonach ohne die vorübergehende Weitergeltung der aufgrund der landesrechtlichen Regelungen erlassenen Verwaltungsvorschriften die für die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung wichtigen Auswahlentscheidungen nicht getroffen werden könnten; siehe demgegenüber BVerwG, Beschluss vom 26. Januar 1995 – 8 B 193.94 –, juris Rn. 8-10; Beschluss vom 10. Februar 2000 – 11 B 54.99 –, juris Rn. 8; Urteil vom 9. Juni 2010 – 9 CN 1.09 –, BVerwGE 137, 123 = juris Rn. 29; OVG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 26. November 2002 – 2 M 96/02 –, juris Rn. 9; HessVGH, Beschluss vom 6. Oktober 2010 – 5 A 2593/09.Z –, juris Rn. 6, jeweils zur Frage – und dies zumindest im Grundsatz verneinend –, ob § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO es den Gerichten gestattet, bei Anfechtungsklagen von der inzidenten Feststellung der Unwirksamkeit einer Satzung oder der daraus resultierenden Aufhebung der auf ihrer Grundlage beruhenden Verwaltungsakte wegen der damit verbundenen mittelbaren Folgen abzusehen).
Die Anordnung einer übergangsweisen Fortgeltung einer verfassungswidrigen Norm kommt grundsätzlich nur in Betracht, wenn und soweit deren Anwendung unerlässlich ist, um grundrechtlich geschützte Rechtspositionen zu wahren oder die Funktionsfähigkeit der staatlichen Verwaltung sicherzustellen; die vorübergehende Fortgeltung der Regelungen wird dann trotz ihrer Unvereinbarkeit mit höherrangigem Recht in Kauf genommen, um noch verfassungsfernere Zustände zu vermeiden (vgl. BVerwG, Beschluss vom 27. Januar 2015 – 6 B 43.14 –, juris Rn. 10; Urteil vom 13. Januar 1982 – 7 C 95.80 –, BVerwGE 64, 308 = juris Rn. 22; Urteil vom 1. Juni 1995 – 2 C 16.94 –, BVerwGE 98, 324 = juris Rn. 16; Urteil vom 30. August 2012 – 2 C 23.10 –, BVerwGE 144, 93 = juris Rn. 16; Beschluss vom 31. Januar 2019 – 1 WB 28.17 –, BVerwGE 164, 304 = juris Rn. 35; Urteil vom 7. Juli 2021 – 2 C 2.21 –, BVerwGE 173, 81 = juris Rn. 40; Beschluss vom 26. Januar 2023 – 1 WB 41.21 –, juris Rn. 23; Beschluss vom 29. August 2023 – 1 WB 60.22 –, juris Rn. 45; BVerfG, Beschluss vom 27. Januar 1976 – 1 BvR 2325/73 –, BVerfGE 41, 251 = juris Rn. 36). Dabei soll der Rechtsgrundsatz der übergangsweisen Anwendung unwirksamer Regelungen nicht nur die Fallgestaltungen des Fehlens der erforderlichen Rechtsnormqualität und der unwirksamen Bekanntmachung der Regelungen erfassen, sondern immer dann Geltung beanspruchen, wenn und soweit ein wirkungsvoller Grundrechtsschutz oder die Funktionsfähigkeit der staatlichen Verwaltung für einen Übergangszeitraum nicht anders als durch die Anwendung der Regelungen gewährleistet werden kann (vgl. BVerwG, Beschluss vom 27. Januar 2015 – 6 B 43.14 –, juris Rn. 11). In solchen Fällen kommt eine Fortgeltungsanordnung insbesondere dann in Betracht, wenn die streitige Rechtsfrage hinsichtlich der Rechtsgültigkeit der Norm in der Rechtsprechung bislang noch nicht – oder anders – entschieden war (vgl. BVerwG, Urteil vom 13. Januar 1982 – 7 C 95.80 –, BVerwGE 64, 308 = juris Rn. 22; Urteil vom 30. August 2012 – 2 C 23.10 –, BVerwGE 144, 93 = juris Rn. 15 f.; Beschluss vom 31. Januar 2019 – 1 WB 28.17 –, BVerwGE 164, 304 = juris Rn. 35 f.; Beschluss vom 26. Januar 2023 – 1 WB 41.21 –, juris Rn. 23; Beschluss vom 29. August 2023 – 1 WB 60.22 –, juris Rn. 45; BVerfG, Urteil vom 10. Februar 2004 – 2 BvR 834/02 –, BVerfGE 109, 190 = juris Rn. 167) bzw. ein Fall gewandelter Verfassungsinterpretation vorliegt (vgl. BVerfG, Beschluss vom 27. Januar 1976 – 1 BvR 2325/73 –, BVerfGE 41, 251 = juris Rn. 36). Jedenfalls darf eine vorübergehende Fortgeltung – ebenso wie eine verwaltungsgerichtliche Übergangsregelung (vgl. BVerwG, Urteil vom 28. Oktober 2020 – 6 C 8.19 –, BVerwGE 170, 1 = juris Rn. 24; Urteil vom 10. April 2019 – 6 C 19.18 –, BVerwGE 165, 202 = juris Rn. 20) – aber nur angeordnet werden, soweit dies im konkreten Fall unerlässlich ist, um die grundrechtlichen geschützten Rechtspositionen zu wahren oder die Funktionsfähigkeit der staatlichen Verwaltung sicherzustellen (vgl. BVerwG, Urteil vom 28. Oktober 2020 – 6 C 8/19 –, BVerwGE 170, 1 = juris Rn. 24; Urteil vom 10. April 2019 – 6 C 19/18 –, BVerwGE 165, 202 = juris Rn. 20; BVerfG, Beschluss vom 27. Januar 1976 – 1 BvR 2325/73 –, BVerfGE 41, 251 = juris Rn. 37; siehe auch BVerfG, Urteil vom 10. Februar 2004 – 2 BvR 834/02 –, BVerfGE 109, 190 = juris Rn. 174 ff.). Darüber hinaus müssen die Regelungen, die durch das Gericht trotz ihrer Unwirksamkeit weiter zur Anwendung gebracht werden sollen, grundsätzlich zumindest ihrem Inhalt nach verfassungsrechtlichen Vorgaben genügen, insbesondere verhältnismäßig sein, und insoweit muss deren weitere Anwendung dem in seinen Rechten Betroffenen zumutbar sein (vgl. dazu BVerwG, Urteil vom 1. Juni 1995 – 2 C 16.94 –, BVerwGE 98, 324 = juris Rn. 16; siehe auch BVerwG, Urteil vom 17. Juni 2004 – 2 C 50.02 –, BVerwGE 121, 103 = juris Rn. 20; Beschluss vom 31. Januar 2019 – 1 WB 28.17 –, BVerwGE 164, 304 = juris Rn. 36; Beschluss vom 29. August 2023 – 1 WB 60.22 –, juris Rn. 49; siehe auch BVerfG, Urteil vom 10. Februar 2004 – 2 BvR 834/02 –, BVerfGE 109, 190 = juris Rn. 174 ff.).
Die Anordnung einer vorübergehenden Fortgeltung des § 3 Abs. 1 Satz 1 FeV scheitert hier aber letztlich daran, dass es dieser Norm – anders als in Fällen, in denen es an einer hinreichenden gesetzlichen Verordnungsermächtigung mangelt, die untergesetzliche Norm selbst aber ansonsten verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist – aufgrund ihrer mangelnden Bestimmtheit gerade an einem hinreichenden und darüber hinaus vor allem auch verhältnismäßigen Regelungsgehalt fehlt, dessen vorübergehende weitere Anwendung angeordnet werden könnte.
Auch der Erlass einer eigenen, verwaltungsgerichtlichen Übergangsregelung kommt hier nicht in Betracht. Zwar wurde § 3 FeV – ungeachtet der insoweit bereits im Jahr 2020 nicht zuletzt vom Bundesverwaltungsgericht geäußerten Zweifel (vgl. hinsichtlich § 3 Abs. 2 FeV BVerwG, Urteil vom 4. Dezember 2020 – 3 C 5.20 – BVerwGE 171, 1 = juris Rn. 32 ff.) – in der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung – soweit ersichtlich – erstmals mit dem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 17. April 2023 (11 BV 22.1234) wegen einer Verletzung des Bestimmtheits- und Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes als unwirksam angesehen. Auch spricht für den Erlass einer gerichtlichen Übergangsregelung der mit der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Satz 1 FeV bezweckte – aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ableitbare und erforderliche – Schutz anderer Verkehrsteilnehmer vor erheblichen Gefahren für Leib und Leben; eine Übergangsregelung könnte insoweit das Entstehen einer Schutzlücke verhindern (vgl. insoweit zum verfassungsgerichtlichen Unvereinbarkeits- statt Nichtigkeitsausspruch BVerfG, Beschluss vom 20. März 2013 – 2 BvF 1/05 –, BVerfGE 133, 241 = juris Rn. 51; Urteil vom 10. Februar 2004 – 2 BvR 834/02 –, BVerfGE 109, 190 = juris Rn. 163 ff.; Beschluss vom 27. November 1990 – 1 BvR 402/87 –, BVerfGE 83, 130 = juris Rn. 82). Da sich allerdings das Verwaltungshandeln – wie gezeigt jedenfalls außerhalb der die Trunkenheitsfahrten betreffenden Eignungsmängel – nicht an anderweitigen, verallgemeinerbaren und – etwa durch die Rechtsprechung oder wissenschaftlich erarbeitete Begutachtungsleitlinien – bereits konkretisierten Vorgaben orientieren kann, ist insbesondere angesichts der Eingriffsintensität der Untersagung des Führens fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge für den Betroffenen und des für die Bewertung der gebotenen Eignungsanforderungen erforderlichen medizinischen und psychologischen Sachverstands eine diesbezügliche (vorübergehende) eigene gerichtliche Handlungsvorgabe ausgeschlossen. Es obliegt vielmehr zuvörderst dem Gesetz- und Verordnungsgeber und nicht den Gerichten, insoweit hinreichend bestimmte und verhältnismäßige Maßstäbe aufzustellen (siehe auch BVerwG, Urteil vom 4. Dezember 2020 – 3 C 5.20 –, BVerwGE 171, 1 = juris Rn. 39).
V. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten ergibt sich aus § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 10 (analog), 711 Zivilprozessordnung – ZPO –.
Die Revision ist wegen grundsätzlicher Bedeutung gemäß § 132 Abs. 2 Nr. 1VwGO zuzulassen, da die streitentscheidende Frage, ob § 3 FeV für die Untersagung des Führens fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge eine hinreichend bestimmte und verhältnismäßige Rechtsgrundlage darstellt, grundsätzliche Bedeutung hat. Eine höchstrichterliche Entscheidung hierzu liegt nicht vor und die Rechtsfrage wird in der obergerichtlichen Rechtsprechung und Literatur nicht einheitlich beantwortet (vgl. BayVGH, Urteil vom 17. April 2023 – 11 BV 22.1234 –, juris Rn. 30; Beschluss vom 12. Juli 2023 – 11 CS 23.551 –, juris Rn. 10; Beschluss vom 25. Juli 2023 – 11 CS 23.125 –, juris Rn. 26; Müller/Rebler, DAR 2023, 437 [440 f.]; offen gelassen hinsichtlich § 3 Abs. 2 FeV in BVerwG, Urteil vom 4. Dezember 2020 – 3 C 5.20 –, BVerwGE 171, 1 = juris Rn. 38; SaarlOVG, Beschluss vom 3. Mai 2021 – 1 B 30/21 –, juris Rn. 40 ff.; zweifelnd auch Zwerger, jurisPR-VerkR 18/2022 Anm. 1; a.A. wohl OVG Nds, Beschluss vom 23. August 2023 – 12 ME 93/23 –, juris Rn. 10, jedenfalls bei der „typischen Fallgestaltung“ des im Anschluss an eine Trunkenheitsfahrt mit mehr als 1,6 ‰ BAK mit dem Fahrrad ausgesprochenen Verbots; Ternig, NZV 2024, 149).