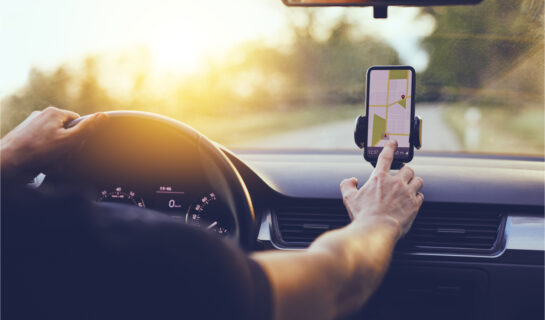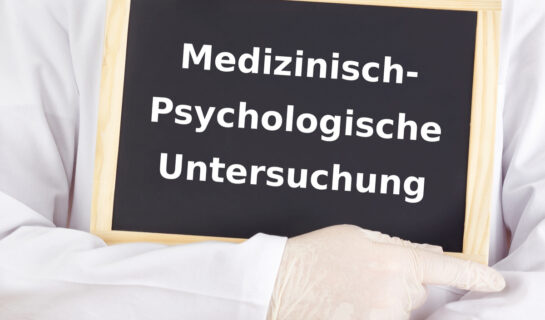Übersicht
- Das Wichtigste: Kurz & knapp
- Notfall auf der Autobahn: Durfte Autofahrer Rettungsgasse nutzen?
- Der Fall vor Gericht
- Die Schlüsselerkenntnisse
- FAQ – Häufige Fragen
- Was versteht man unter einer notstandsähnlichen Situation im Straßenverkehr?
- Wann kann ein dringendes Bedürfnis zur Notdurft eine rechtliche Grundlage für das Absehen von einem Fahrverbot bieten?
- Welche Schritte sollte man unternehmen, wenn man aufgrund einer Notstandssituation gegen eine Verkehrsregel verstoßen hat?
- Welche Rolle spielt die Einzelfallprüfung bei der Entscheidung über ein Fahrverbot wegen einer Notstandssituation?
- Welche Konsequenzen drohen, wenn eine Notstandssituation nicht anerkannt wird?
- Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Wichtige Rechtsgrundlagen
- Das vorliegende Urteil
Das Wichtigste: Kurz & knapp
- Es ging um ein Urteil hinsichtlich der Benutzung einer freien Gasse für Hilfsfahrzeuge auf der Autobahn.
- Der Betroffene wurde wegen fahrlässiger unberechtigter Nutzung einer solchen Gasse verurteilt.
- Eine besondere Schwierigkeit war die Abwägung der Umstände des Einzelfalls, insbesondere ein dringendes Bedürfnis.
- Das Amtsgericht Witten sah von einem Fahrverbot ab und verhängte lediglich eine Geldbuße.
- Das Gericht entschied so, weil das Handlungsunrecht je nach Umständen des Einzelfalls als nicht gegeben angesehen werden kann.
- Die Rechtsbeschwerde der Staatsanwaltschaft gegen dieses Urteil wurde als unbegründet verworfen.
- Die Entscheidung betont die Wichtigkeit, individuelle Umstände und mögliche Irrtümer in rechtlichen Fragen zu berücksichtigen.
- Die Kosten des Verfahrens trägt die Staatskasse, was den finanziellen Druck auf den Betroffenen mindert.
- Die Urteilsbegründung zeigt, dass Fahrverbote nicht zwangsläufig sind und unter bestimmten Bedingungen vermieden werden können.
- Dieses Urteil könnte Einfluss darauf haben, wie ähnliche Fälle in Zukunft beurteilt werden.
Notfall auf der Autobahn: Durfte Autofahrer Rettungsgasse nutzen?

Das Fahren unter Alkoholeinfluss ist in Deutschland verboten und wird mit hohen Strafen geahndet. Nicht selten steht neben dem Bußgeld auch ein Fahrverbot im Raum. Allerdings gibt es auch Ausnahmen von dieser Regel – zum Beispiel im Falle einer sogenannten „notstandsähnlichen Situation“.
Eine solche Situation liegt vor, wenn eine Gefahr von unmittelbarer, ernster und erheblicher Bedeutung droht, die nur durch den Verstoß gegen eine Rechtsnorm abgewendet werden kann.
Hierbei handelt es sich um eine sehr anspruchsvolle rechtliche Hürde, die nur in Ausnahmefällen erfüllt ist. In der Rechtsprechung wird beispielsweise die Verrichtung der Notdurft in Verbindung mit einer akuten Gesundheitsgefahr als notstandsähnliche Situation anerkannt.
In einem aktuellen Gerichtsfall ging es um die Frage, ob das Absehen von einem Fahrverbot trotz eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gerechtfertigt war. Es stellt sich die Frage, ob in diesem speziellen Fall die Voraussetzungen einer notstandsähnlichen Situation gegeben waren und ob das Gericht ein Absehen vom Fahrverbot rechtlich begründen konnte.
Fahrverbot droht? Wir kennen Ihre Rechte!
Wurden Sie wegen eines Verkehrsverstoßes mit Fahrverbot belegt, obwohl Sie sich in einer Notsituation befanden? Unsere Kanzlei ist spezialisiert auf Verkehrsrecht und verfügt über langjährige Erfahrung in der Verteidigung von Mandanten in ähnlichen Fällen. Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Ersteinschätzung Ihres Falls. Wir prüfen Ihre rechtlichen Möglichkeiten und beraten Sie umfassend zu Ihren individuellen Handlungsoptionen.
Der Fall vor Gericht
Fahrverbot trotz Notdurft: OLG Hamm entscheidet über notstandsähnliche Situation
Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm hat in einem bemerkenswerten Fall über die Rechtmäßigkeit eines Fahrverbots entschieden. Ein Autofahrer war auf der Autobahn wegen der unberechtigten Benutzung einer Rettungsgasse belangt worden, hatte jedoch geltend gemacht, dass er aufgrund eines dringenden Bedürfnisses zur Notdurft gehandelt habe. Diese Argumentation führte zu einer juristischen Auseinandersetzung darüber, ob hier eine notstandsähnliche Situation vorlag, die ein Absehen vom Fahrverbot rechtfertigen könnte.
Unberechtigte Nutzung der Rettungsgasse und rechtliche Folgen
Der Fall begann damit, dass der Betroffene auf einer Autobahn mit seinem Fahrzeug eine Rettungsgasse benutzte, die eigentlich für Polizei- und Hilfsfahrzeuge freigehalten werden muss. Dieses Verhalten stellt normalerweise eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Bußgeld und in der Regel auch mit einem Fahrverbot geahndet wird. Das Amtsgericht Witten hatte den Autofahrer zunächst zu einer Geldbuße von 240 Euro verurteilt, sah jedoch von der Verhängung eines Fahrverbots ab.
Die Staatsanwaltschaft Bochum legte gegen diese Entscheidung Rechtsbeschwerde ein. Sie war der Ansicht, dass zusätzlich zur Geldbuße ein Fahrverbot hätte verhängt werden müssen. Damit landete der Fall vor dem Oberlandesgericht Hamm, das nun zu entscheiden hatte, ob das Absehen vom Fahrverbot rechtmäßig war.
OLG Hamm: Einzelfallprüfung bei notstandsähnlichen Situationen
Das OLG Hamm hat in seinem Beschluss wichtige Grundsätze für die Beurteilung solcher Fälle aufgestellt. Die Richter betonten, dass bei der Frage, ob ein grober Verstoß vorliegt, der ein Fahrverbot rechtfertigt, stets die Umstände des Einzelfalls gegeneinander abgewogen werden müssen. Dabei sind auch mögliche Irrtümer des Betroffenen zu berücksichtigen.
Besonders bemerkenswert ist die Einschätzung des Gerichts zu notstandsähnlichen Situationen. Das OLG Hamm stellte fest, dass bei einem dringenden Bedürfnis zur Verrichtung der Notdurft – je nach den konkreten Umständen des Einzelfalls – das für die Anordnung eines Fahrverbots erforderliche Handlungsunrecht fehlen kann. Mit anderen Worten: Wenn jemand wirklich dringend auf die Toilette muss, kann dies unter Umständen ein Grund sein, von einem Fahrverbot abzusehen.
Auswirkungen des Urteils auf zukünftige Fälle
Die Entscheidung des OLG Hamm könnte weitreichende Folgen für ähnlich gelagerte Fälle haben. Sie öffnet die Tür für eine differenziertere Betrachtung von Verkehrsverstößen, bei denen der Fahrer unter einem akuten Handlungsdruck stand. Allerdings betont das Gericht auch, dass es immer auf die spezifischen Umstände des Einzelfalls ankommt.
Autofahrer sollten nicht davon ausgehen, dass sie nun generell bei dringendem Harndrang eine Rettungsgasse benutzen dürfen. Die Entscheidung des OLG Hamm bedeutet lediglich, dass Gerichte in Zukunft möglicherweise offener für Argumente sein werden, die auf eine notstandsähnliche Situation hindeuten. Ob tatsächlich von einem Fahrverbot abgesehen wird, hängt von einer sorgfältigen Abwägung aller Umstände ab.
Die Schlüsselerkenntnisse
Die Entscheidung des OLG Hamm unterstreicht die Notwendigkeit einer differenzierten Einzelfallbetrachtung bei Verkehrsverstößen, insbesondere wenn notstandsähnliche Situationen geltend gemacht werden. Das Gericht erkennt an, dass ein dringendes Bedürfnis zur Verrichtung der Notdurft unter Umständen das für ein Fahrverbot erforderliche Handlungsunrecht ausschließen kann. Dies eröffnet zwar keinen Freibrief für die Nutzung von Rettungsgassen, schafft aber Raum für eine nuanciertere rechtliche Bewertung in ähnlich gelagerten Fällen.
Was bedeutet das Urteil für Sie?
Das Urteil des Oberlandesgerichts Hamm könnte für Sie relevant sein, wenn Sie einen Verkehrsverstoß begangen haben, aber der Meinung sind, dass eine Notsituation vorlag. Es zeigt, dass Gerichte dazu verpflichtet sind, alle Umstände des Einzelfalls abzuwägen, bevor sie ein Fahrverbot verhängen.
Konkret bedeutet dies: Wenn Sie beispielsweise die Rettungsgasse widerrechtlich benutzt haben, weil Sie dringend auf die Toilette mussten, könnte dies als „notstandsähnliche Situation“ gewertet werden. Das Gericht müsste dann prüfen, ob Ihr Handeln gerechtfertigt war und ob ein Fahrverbot in Ihrem Fall angemessen ist.
Wichtig zu beachten: Das Urteil bedeutet nicht, dass Sie bei jedem dringenden Bedürfnis die Verkehrsregeln missachten dürfen. Es kommt immer auf den Einzelfall und die Schwere des Verstoßes an. Im Zweifel sollten Sie sich immer an einen Anwalt wenden, um Ihre individuelle Situation zu klären.
FAQ – Häufige Fragen
Wer kennt das nicht: Eine Notfallsituation tritt ein und man muss schnell handeln, aber die Verkehrsregeln stehen einem im Weg. Doch wann ist eine Notstandssituation wirklich gerechtfertigt? Diese und weitere wichtige Fragen zum Thema Notstand und Verkehrsrecht beantworten wir in unseren FAQ.
Wichtige Fragen, kurz erläutert:
- Was versteht man unter einer notstandsähnlichen Situation im Straßenverkehr?
- Wann kann ein dringendes Bedürfnis zur Notdurft eine rechtliche Grundlage für das Absehen von einem Fahrverbot bieten?
- Welche Schritte sollte man unternehmen, wenn man aufgrund einer Notstandssituation gegen eine Verkehrsregel verstoßen hat?
- Welche Rolle spielt die Einzelfallprüfung bei der Entscheidung über ein Fahrverbot wegen einer Notstandssituation?
- Welche Konsequenzen drohen, wenn eine Notstandssituation nicht anerkannt wird?
Was versteht man unter einer notstandsähnlichen Situation im Straßenverkehr?
Eine notstandsähnliche Situation im Straßenverkehr bezeichnet einen Ausnahmezustand, bei dem ein Verkehrsteilnehmer aufgrund besonderer Umstände gezwungen ist, gegen Verkehrsregeln zu verstoßen. Diese Konstellation ähnelt einem rechtfertigenden Notstand, erreicht jedoch nicht dessen strenge gesetzliche Voraussetzungen.
Gerichte erkennen notstandsähnliche Situationen in eng begrenzten Fällen an, um von der Verhängung eines Fahrverbots abzusehen. Ein klassisches Beispiel ist das dringende Bedürfnis zur Verrichtung der Notdurft. Hierbei muss der Betroffene darlegen, dass er subjektiv nicht besonders verantwortungslos handelte und objektiv keine andere Möglichkeit hatte, rechtzeitig eine Toilette zu erreichen.
Die Rechtsprechung stellt hohe Anforderungen an den Nachweis einer notstandsähnlichen Situation. Es reicht nicht aus, dass lediglich eine Notlage bestand. Vielmehr müssen zusätzliche Umstände hinzukommen, die die Situation als außergewöhnlich kennzeichnen. Der Verkehrsteilnehmer muss sich in einer Zwangslage befunden haben, die ein Abweichen von den Verkehrsregeln unausweichlich machte.
Weitere anerkannte Fallgruppen umfassen etwa die dringende Sorge um ein verunfalltes Kind oder die eilige Fahrt eines Arztes zu einem medizinischen Notfall. Auch hier prüfen Gerichte kritisch, ob tatsächlich keine andere Handlungsoption bestand und ob die Gefahr so akut war, dass ein Verstoß gegen Verkehrsvorschriften gerechtfertigt erscheint.
Entscheidend ist stets eine sorgfältige Abwägung der widerstreitenden Interessen im Einzelfall. Das Gericht muss das Interesse des Betroffenen an der Regelverletzung gegen das öffentliche Interesse an der Sicherheit des Straßenverkehrs abwägen. Nur wenn das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt, kann eine notstandsähnliche Situation angenommen werden.
Es ist wichtig zu betonen, dass eine notstandsähnliche Situation kein Freibrief für rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr darstellt. Selbst in Ausnahmesituationen müssen Verkehrsteilnehmer die Sicherheit anderer bestmöglich berücksichtigen. Die Geschwindigkeitsüberschreitung oder das Überfahren einer roten Ampel dürfen nur in dem Maße erfolgen, wie es zur Abwendung der konkreten Gefahr unbedingt erforderlich ist.
Wer sich auf eine notstandsähnliche Situation beruft, trägt die Beweislast für deren Vorliegen. Der Betroffene muss detailliert darlegen, warum er sich in einer Zwangslage befand und weshalb keine andere Handlungsmöglichkeit bestand. Pauschale Behauptungen oder nachträgliche Schutzbehauptungen werden von den Gerichten in der Regel nicht akzeptiert.
Die Anerkennung einer notstandsähnlichen Situation führt nicht automatisch zur Straffreiheit. Vielmehr kann sie dazu führen, dass das Gericht von der Verhängung eines Fahrverbots absieht. Die Geldbuße und eventuelle Punkte im Fahreignungsregister bleiben in der Regel bestehen, können aber unter Umständen gemildert werden.
Wann kann ein dringendes Bedürfnis zur Notdurft eine rechtliche Grundlage für das Absehen von einem Fahrverbot bieten?
Ein dringendes Bedürfnis zur Notdurft kann unter bestimmten Umständen tatsächlich eine rechtliche Grundlage für das Absehen von einem Fahrverbot bieten. Die Gerichte betrachten solche Situationen als notstandsähnliche Lagen, die das Handlungsunrecht eines Verkehrsverstoßes mindern können.
Entscheidend ist dabei, dass nicht jedes gewöhnliche Toilettenbedürfnis ausreicht. Es muss sich um eine außergewöhnlich dringende Situation handeln, die den Fahrer in eine Zwangslage versetzt. Gerichte prüfen hier sehr genau die konkreten Umstände des Einzelfalls.
Ein Beispiel wäre ein plötzlich auftretender, starker Harndrang aufgrund einer Medikamentenwirkung. Wenn der Fahrer glaubhaft darlegen kann, dass er subjektiv keine andere Möglichkeit sah, als schnellstmöglich eine Toilette aufzusuchen, kann dies zu seinen Gunsten berücksichtigt werden. Auch gesundheitliche Probleme wie Blasenschwäche oder Darmerkrankungen können relevant sein, wenn sie zu einer akuten Notsituation führen.
Wichtig ist, dass der Betroffene alle zumutbaren Alternativen ausgeschöpft haben muss. Hat er beispielsweise kurz zuvor eine Raststätte passiert, ohne anzuhalten, schwächt dies seine Position. Die Gerichte erwarten, dass Fahrer ihr Verhalten im Rahmen des Möglichen vorausschauend planen.
Bei der rechtlichen Bewertung spielt auch eine Rolle, wie schwerwiegend der begangene Verkehrsverstoß war. Eine moderate Geschwindigkeitsüberschreitung wird eher toleriert als ein grob rücksichtsloses Fahrmanöver. Die Richter wägen stets ab zwischen dem Schutz der Verkehrssicherheit und der Notlage des Betroffenen.
Beachtenswert ist zudem, dass ein dringendes Toilettenbedürfnis zwar ein Absehen vom Fahrverbot begründen kann, andere Sanktionen wie Bußgelder aber in der Regel bestehen bleiben. Die Notlage entschuldigt den Verstoß nicht vollständig, sondern mildert lediglich seine Bewertung.
Für eine erfolgreiche Argumentation vor Gericht sollten Betroffene möglichst detailliert und glaubwürdig ihre Situation schildern. Ärztliche Atteste oder Zeugenaussagen können die Darstellung unterstützen. Je nachvollziehbarer die Zwangslage erscheint, desto eher werden Richter geneigt sein, von einem Fahrverbot abzusehen.
Es bleibt festzuhalten, dass ein dringendes Bedürfnis zur Notdurft in Ausnahmefällen tatsächlich rechtlich relevant sein kann. Die Hürden sind jedoch hoch, und eine sorgfältige Einzelfallprüfung ist unerlässlich. Autofahrer sollten sich bewusst sein, dass sie trotz persönlicher Notlagen grundsätzlich zur Einhaltung der Verkehrsregeln verpflichtet sind.
Welche Schritte sollte man unternehmen, wenn man aufgrund einer Notstandssituation gegen eine Verkehrsregel verstoßen hat?
Bei einem Verkehrsregelverstoß aufgrund einer Notstandssituation sollten Betroffene zunächst die Situation dokumentieren. Dazu gehört, den genauen Ablauf der Ereignisse schriftlich festzuhalten und wenn möglich Beweise zu sichern. Fotos oder Videos können hilfreich sein, um die Notlage zu belegen. Zeugenaussagen sollten ebenfalls eingeholt und notiert werden.
Unverzüglich nach dem Vorfall ist es ratsam, einen Rechtsanwalt zu konsultieren. Ein Fachanwalt für Verkehrsrecht kann die Situation rechtlich einordnen und die weiteren Schritte planen. Er kann auch bei der Formulierung eines Einspruchs gegen einen möglichen Bußgeldbescheid unterstützen.
Wird ein Bußgeldbescheid zugestellt, muss innerhalb von zwei Wochen Einspruch eingelegt werden. Der Einspruch sollte schriftlich erfolgen und eine ausführliche Begründung der Notstandssituation enthalten. Dabei ist es wichtig, die konkrete Gefahr für ein Rechtsgut wie Leben, Gesundheit oder Eigentum darzulegen.
Die Behörde prüft dann, ob tatsächlich ein rechtfertigender Notstand nach § 16 des Ordnungswidrigkeitengesetzes vorlag. Dafür muss die Gefahr gegenwärtig und nicht anders abwendbar gewesen sein. Zudem muss das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegen.
Wird der Einspruch abgelehnt, kann der Fall vor Gericht verhandelt werden. Hier ist es wichtig, alle Beweise und Zeugenaussagen vorzulegen, die den Notstand belegen. Das Gericht wird dann eine Abwägung vornehmen zwischen der Schwere des Verkehrsverstoßes und der abgewendeten Gefahr.
Selbst wenn kein vollständiger rechtfertigender Notstand anerkannt wird, kann eine „notstandsähnliche Situation“ zu einer Milderung der Strafe führen. So kann beispielsweise von einem Fahrverbot abgesehen werden, wenn eine dringende Notdurft der Grund für eine Geschwindigkeitsüberschreitung war.
Betroffene sollten bedenken, dass die Anforderungen an einen rechtfertigenden Notstand im Straßenverkehr sehr hoch sind. Nur in Extremsituationen, bei denen eine erhebliche Gefahr für wichtige Rechtsgüter bestand, wird ein Verkehrsverstoß gerechtfertigt sein. Die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer darf dabei nicht unverhältnismäßig gefährdet worden sein.
Welche Rolle spielt die Einzelfallprüfung bei der Entscheidung über ein Fahrverbot wegen einer Notstandssituation?
Die Einzelfallprüfung spielt eine zentrale Rolle bei der Entscheidung über ein Fahrverbot in Notstandssituationen. Gerichte sind verpflichtet, die spezifischen Umstände jedes Falls sorgfältig abzuwägen, bevor sie ein Fahrverbot verhängen oder davon absehen.
Bei der Beurteilung berücksichtigen die Richter verschiedene Faktoren. Das subjektive Handlungsunrecht des Betroffenen steht dabei im Fokus. Es wird geprüft, ob die Person in der konkreten Situation besonders verantwortungslos gehandelt hat oder ob nachvollziehbare Gründe für den Verstoß vorlagen. Medizinische Notlagen oder plötzlich auftretende dringende Bedürfnisse können das Handlungsunrecht mindern.
Auch der objektive Erfolgsunwert der Pflichtverletzung fließt in die Bewertung ein. Die Gerichte prüfen, wie gravierend die tatsächliche Gefährdung oder Beeinträchtigung anderer Verkehrsteilnehmer war. Ein zwischenzeitlich wieder freigegebener Verkehr kann beispielsweise den Erfolgsunwert abschwächen.
Die Richter müssen zudem abwägen, ob alternative Handlungsmöglichkeiten für den Betroffenen zumutbar gewesen wären. Bei einem dringenden Toilettengang auf der Autobahn wird etwa berücksichtigt, ob das Verlassen des Fahrzeugs eine realistische Option dargestellt hätte.
Irrtumsaspekte spielen ebenfalls eine wichtige Rolle in der Einzelfallprüfung. Hat der Betroffene die Situation falsch eingeschätzt, etwa eine vermeintliche Verkehrsfreigabe angenommen, kann dies zu seinen Gunsten gewertet werden.
Die Gerichte prüfen des Weiteren, ob eine echte Notsituation vorlag. Ein dringendes medizinisches Problem oder eine andere akute Notlage können ein Abweichen von den Verkehrsregeln eher rechtfertigen als alltägliche Unannehmlichkeiten.
Die Schwere des Verstoßes wird ebenfalls berücksichtigt. Bei gravierenden Übertretungen oder wiederholten Verstößen sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass von einem Fahrverbot abgesehen wird. Einmonatige Fahrverbote lassen sich tendenziell leichter abwenden als mehrmonatige.
Die Einzelfallprüfung ermöglicht es den Gerichten, die Bußgeldkatalog-Verordnung flexibel anzuwenden. Trotz der Indizwirkung der Verordnung besteht kein Automatismus bei der Verhängung von Fahrverboten. Die Richter haben einen Ermessensspielraum, um die Umstände des Einzelfalls angemessen zu würdigen.
Für die Betroffenen bedeutet die Einzelfallprüfung, dass sie die Chance haben, ihre individuellen Umstände darzulegen. Eine detaillierte Schilderung der Notlage und der Beweggründe kann die gerichtliche Entscheidung beeinflussen. Beweismittel wie ärztliche Atteste können dabei hilfreich sein, um die Glaubwürdigkeit zu untermauern.
Die sorgfältige Abwägung aller Umstände durch die Gerichte gewährleistet eine ausgewogene Rechtsprechung. Sie verhindert, dass Fahrverbote schematisch verhängt werden und ermöglicht es, Härtefälle angemessen zu berücksichtigen. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die präventive Wirkung von Fahrverboten nicht durch zu großzügige Ausnahmen untergraben wird.
Welche Konsequenzen drohen, wenn eine Notstandssituation nicht anerkannt wird?
Wenn eine Notstandssituation rechtlich nicht anerkannt wird, drohen dem Betroffenen die regulären strafrechtlichen oder ordnungsrechtlichen Konsequenzen für sein Handeln. Das Gericht oder die Behörde behandelt den Fall dann so, als hätte keine besondere Ausnahmesituation vorgelegen.
Bei einer Verkehrsordnungswidrigkeit wie einem Parkverstoß bedeutet dies, dass das ursprünglich verhängte Bußgeld und gegebenenfalls ein Fahrverbot bestehen bleiben. Der Betroffene muss die Strafe in vollem Umfang zahlen und das Fahrverbot antreten. Eine Reduzierung oder Aufhebung der Sanktion aufgrund besonderer Umstände erfolgt nicht.
In strafrechtlichen Fällen kann die Nichtanerkennung einer Notstandssituation schwerwiegende Folgen haben. Das Gericht wertet die Handlung dann als vorsätzliche oder fahrlässige Straftat. Je nach Delikt drohen Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafen. Bei Sachbeschädigung etwa kann eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren verhängt werden. Die Tat wird im Bundeszentralregister eingetragen, was sich negativ auf künftige Bewerbungen oder behördliche Entscheidungen auswirken kann.
Auch zivilrechtliche Konsequenzen sind möglich. Der vermeintlich im Notstand Handelnde haftet für entstandene Schäden und muss diese ersetzen. Bei einer aufgebrochenen Hütte müsste er beispielsweise für die Reparatur der Tür aufkommen.
Die Nichtanerkennung einer Notstandssituation kann zudem prozessuale Nachteile mit sich bringen. Gerichte bewerten das Vorbringen des Betroffenen möglicherweise als Schutzbehauptung, was seine Glaubwürdigkeit insgesamt beeinträchtigen kann. Dies kann sich auf die Beweiswürdigung und letztlich das Urteil auswirken.
Für die rechtliche Verteidigung ergeben sich ebenfalls Konsequenzen. Alternative Argumentationslinien oder mildernde Umstände müssen geprüft werden. Eventuell ist die Einlegung von Rechtsmitteln wie Berufung oder Revision zu erwägen, um die Notstandssituation in der nächsten Instanz anerkennen zu lassen.
Die Nichtanerkennung einer Notstandssituation kann also weitreichende rechtliche und persönliche Folgen haben. Es ist daher ratsam, solche Situationen sorgfältig zu dokumentieren und im Zweifel rechtlichen Beistand hinzuzuziehen. Nur so lässt sich die Chance erhöhen, dass eine tatsächlich vorliegende Notlage auch vor Gericht oder Behörden anerkannt wird.
Glossar – Fachbegriffe kurz erklärt
- Notstandsähnliche Situation: Eine Lage, in der eine unmittelbare, ernsthafte Gefahr nur durch einen Rechtsverstoß abgewendet werden kann. Im Straßenverkehr kann dies z.B. ein dringendes medizinisches Problem sein. Die Situation muss so akut sein, dass ein Abwarten unzumutbar wäre. Gerichte prüfen dabei streng, ob wirklich keine andere Handlungsmöglichkeit bestand. Ein klassisches Beispiel wäre das Überfahren einer roten Ampel, um einem Krankenwagen Platz zu machen. Die Anerkennung einer notstandsähnlichen Situation kann rechtliche Konsequenzen mildern oder aufheben.
- Handlungsunrecht: Das Maß der Pflichtwidrigkeit einer Tat. Es beschreibt, wie sehr ein Verhalten von der rechtlichen Norm abweicht. Bei Verkehrsdelikten wird geprüft, ob der Täter vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat und wie gefährlich sein Verhalten war. Ein geringes Handlungsunrecht kann dazu führen, dass von einem Fahrverbot abgesehen wird. Im Fall der Notdurft argumentierte das Gericht, dass das Handlungsunrecht aufgrund der Zwangslage möglicherweise entfallen könnte. Die Bewertung hängt stark vom Einzelfall ab.
- Einzelfallprüfung: Eine genaue Untersuchung aller Umstände eines konkreten Rechtsfalles. Gerichte sind verpflichtet, jede Situation individuell zu betrachten, statt pauschale Urteile zu fällen. Bei Verkehrsdelikten werden z.B. Ort, Zeit, Wetterbedingungen, persönliche Umstände des Fahrers und mögliche Gefährdungen berücksichtigt. Im Fall der Notdurft prüfte das Gericht, wie dringend das Bedürfnis war, ob Alternativen bestanden und wie gefährlich die Nutzung der Rettungsgasse war. Die Einzelfallprüfung soll ein gerechtes, der Situation angemessenes Urteil ermöglichen.
- Rettungsgasse: Ein freizuhaltender Fahrstreifen auf mehrspurigen Straßen, der Einsatzfahrzeugen bei Stau oder stockendem Verkehr die Durchfahrt ermöglicht. Sie muss laut § 11 Abs. 2 StVO zwischen dem äußersten linken und dem unmittelbar rechts daneben liegenden Fahrstreifen gebildet werden. Die unberechtigte Nutzung ist eine Ordnungswidrigkeit nach § 49 Abs. 1 Nr. 11 StVO. Sie wird mit einem Bußgeld von mindestens 200 Euro, einem Punkt im Fahreignungsregister und möglicherweise einem Fahrverbot geahndet. Die strikte Regelung soll Rettungskräften im Notfall freie Fahrt garantieren.
- Rechtsbeschwerde: Ein Rechtsmittel gegen Entscheidungen in Ordnungswidrigkeitenverfahren, geregelt in §§ 79 ff. OWiG. Sie kann nur auf Rechtsfehler, nicht auf Tatsachenfeststellungen gestützt werden. Im vorliegenden Fall legte die Staatsanwaltschaft Rechtsbeschwerde ein, weil sie die Nicht-Verhängung des Fahrverbots für rechtswidrig hielt. Das Oberlandesgericht prüft dann, ob das Amtsgericht das Gesetz richtig angewendet hat. Die Rechtsbeschwerde dient der Vereinheitlichung der Rechtsprechung und der Klärung grundsätzlicher Rechtsfragen.
- Ermessensspielraum: Der rechtliche Freiraum, den Behörden oder Gerichte bei Entscheidungen haben. Er ist durch §§ 39, 40 VwVfG und § 46 OWiG gesetzlich verankert. Bei Verkehrsdelikten können Richter z.B. die Höhe des Bußgeldes oder die Dauer eines Fahrverbots innerhalb bestimmter Grenzen festlegen. Im Fall der Notdurft nutzte das Amtsgericht seinen Ermessensspielraum, um von einem Fahrverbot abzusehen. Das Oberlandesgericht prüfte, ob dieser Ermessensspielraum rechtmäßig ausgeübt wurde. Der Ermessensspielraum soll eine einzelfallgerechte Entscheidung ermöglichen.
Wichtige Rechtsgrundlagen
- § 24 StVG (Straßenverkehrsgesetz): Dieser Paragraph regelt die Voraussetzungen für ein Fahrverbot, das bei groben oder wiederholten Verkehrsverstößen verhängt werden kann. Im vorliegenden Fall wurde geprüft, ob die unberechtigte Nutzung der Rettungsgasse einen solchen groben Verstoß darstellt.
- § 19 OWiG (Ordnungswidrigkeitengesetz): Dieser Paragraph definiert, was eine Ordnungswidrigkeit ist und welche Sanktionen dafür verhängt werden können. Die unberechtigte Nutzung der Rettungsgasse stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die in der Regel mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot geahndet wird.
- § 34 StVO (Straßenverkehrs-Ordnung): Dieser Paragraph regelt die Bildung und Nutzung von Rettungsgassen auf Autobahnen. Das Befahren der Rettungsgasse ohne Berechtigung stellt einen Verstoß gegen diese Vorschrift dar.
- § 46 OWiG (Ordnungswidrigkeitengesetz): Dieser Paragraph regelt den Rechtsbegriff des „Unrechts“ und legt fest, dass eine Handlung nur dann eine Ordnungswidrigkeit darstellt, wenn sie rechtswidrig und vorwerfbar ist. Im vorliegenden Fall wurde geprüft, ob das dringende Bedürfnis zur Notdurft das Unrecht der Handlung entfallen lässt.
- § 16 OWiG (Ordnungswidrigkeitengesetz): Dieser Paragraph regelt die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und gibt den Gerichten einen Ermessensspielraum bei der Festsetzung von Sanktionen. Im vorliegenden Fall hat das Amtsgericht von diesem Ermessensspielraum Gebrauch gemacht und von der Verhängung eines Fahrverbots abgesehen.
Das vorliegende Urteil
OLG Hamm – Az.: III-5 ORbs 35/24 – Beschluss vom 28.03.2024
1. Bei der Frage, ob ein grober Verstoß gegeben ist, sind die Umstände des Einzelfalles – auch unter Berücksichtigung von Irrtumsaspekten – gegeneinander abzuwägen.
2. Bei (z.B. tatrichterlich festgestelltes dringendes Bedürfnis zur) kann – je nach den Umständen des Einzelfalls – das Handlungsunrecht für die Anordnung eines Fahrverbots fehlen.
Die Rechtsbeschwerde der Staatsanwaltschaft Bochum wird als unbegründet verworfen.
Die Kosten der Rechtsbeschwerde und die notwendigen Auslagen des Betroffenen fallen der Staatskasse zu Last (§ 79 Abs. 3 OWiG i.V.m. § 473 Abs. 1, 2 StPO).
Gründe
I.
Das Amtsgericht Witten hat den Betroffenen durch Urteil vom 28.11.2023 wegen fahrlässiger unberechtigter Benutzung einer freien Gasse für die Durchfahrt von Polizei- oder Hilfsfahrzeugen auf einer Autobahn mit einem Fahrzeug zu einer Geldbuße in Höhe von 240 Euro verurteilt und von der Verhängung eines Fahrverbots abgesehen. Gegen dieses Urteil richtet sich die (zulässige) Rechtsbeschwerde der Staatsanwaltschaft Bochum, die die Verletzung materiellen Rechts rügt.
Lesen Sie jetzt weiter…
Die Generalstaatsanwaltschaft hat beantragt, das angefochtene Urteil im Rechtsfolgenausspruch mit den insoweit getroffenen Feststellungen aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Amtsgericht Witten zurückzuverweisen.
II.
Die zu Lasten des Betroffenen eingelegte Rechtsbeschwerde ist unbegründet, da das angefochtene Urteil keinen Rechtsfehler aufweist. Das Tatgericht ist im Rechtsfolgenausspruch in rechtlich nicht zu beanstandender Weise davon ausgegangen, dass – trotz der Indizwirkung der Bußgeldkatalogverordnung (§ 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BKatV) – kein Fall der groben Verletzung der Pflichten eines Fahrzeugführers i.S.v. § 25 Abs. 1 S. 1 StVG vorliegt; im Einzelnen:
1)
Eine grobe Pflichtverletzung liegt dann vor, wenn die Pflichtverletzung des Betroffenen objektiv abstrakt oder konkret besonders gefährlich gewesen ist (vgl. OLG Düsseldorf Entscheidung v. 28.7.1998 – 5 Ss (OWi) 235/98 = BeckRS 1998, 155012, beck-online). Hinzukommen muss, dass der Täter auch subjektiv besonders verantwortungslos handelt (vgl. BGH, NZV 1997, 525, beck-online). Regelbeispiele für ein derartiges Verhalten finden sich in § 4 Abs. 1, 2 BKatV. Bei diesen Katalogtaten ist das Vorliegen einer groben Verletzung der Pflichten eines Kfz-Führers zwar indiziert (vgl. BGHSt 38, 125 (134) = NZV 1992, 117); die Regelbeispiele ersetzen aber nicht gesetzliche Merkmal des § 25 I StVG. Die Bußgeldkatalogverordnung befreit daher die Tatgerichte nicht von der Erforderlichkeit einer Einzelfallprüfung; sie schränkt nur den Begründungsaufwand ein (vgl. BVerfG, DAR 1996, 196 (198) = NZV 1996, 284; BGHSt 38, 125 (136) = NZV 1992, 117 (120). Dementsprechend muss eine im Sinne der Regelbeispiele der Bußgeldkatalogverordnung tatbestandsmäßige Handlung dann (ausnahmsweise) nicht zwingend mit einem Fahrverbot geahndet werden, wenn als Ergebnis der gebotenen Würdigung der Umstände des Einzelfalles eine grobe Pflichtverletzung – sei es in objektiver oder in subjektiver Hinsicht -ausscheidet (vgl. BGH NZV 1997, 525, beck-online). Bei der Frage, ob ein grober Verstoß gegeben ist, sind die Umstände des Einzelfalles – auch unter Berücksichtigung von Irrtumsaspekten – gegeneinander abzuwägen (vgl. OLG Bamberg Beschl. v. 1.12.2015 – 3 Ss OWi 834/15, BeckRS 2015, 20269 Rn. 12, beck-online).
2)
Das Amtsgericht hat in der angefochtenen Entscheidung im Einzelnen dargelegt, warum es im vorliegenden Einzelfall von der Anordnung des einmonatigen Fahrverbots ausnahmsweise abgesehen hat (vgl. UA S. 6 – 8). Zwar deuten die Urteilsgründe darauf hin, dass das Amtsgericht von einem Erlaubnistatbestandsirrtum des Betroffenen ausgeht, obwohl die irrige Annahme des Betroffenen von der Freigabe des Verkehrs die Tatbestandsmäßigkeit des Handelns (§ 11 OWiG) betrifft. Allerdings beruht die angefochtene Entscheidung nicht darauf, da diese Erwägung nicht tragend ist. Vielmehr stellt das Tatgericht bei seiner Begründung des Absehens vom Fahrverbot darauf ab, dass der Betroffene nach den Umständen des Einzelfalls subjektiv nicht besonders verantwortungslos handelte. Das ist rechtlich nicht zu beanstanden.
3)
Es ist in der obergerichtlichen Rechtsprechung anerkannt, dass in notstandsähnlichen Situationen (konkret: dringendes Bedürfnis zur Verrichtung der Notdurft) das Handlungsunrecht für die Anordnung eines Fahrverbotes – je nach den Umständen des Einzelfalls – fehlen kann (vgl. bei Geschwindigkeitsverstößen: OLG Hamm Beschl. v. 10.10.2017 – 4 RBs 326/17 = BeckRS 2017, 129512 Rn. 7, beck-online; OLG Zweibrücken, Beschluss vom 19.12.1996 – 1 Ss 291/96 = NStZ-RR 1997, 379, beck-online; OLG Brandenburg (1. Strafsenat – Senat für Bußgeldsachen), Beschluss vom 25.02.2019 – (1 B) 53 Ss-OWi 41/19 (45/19) = BeckRS 2019, 2716, beck-online). Das ist hier auf der Grundlage – der revisionsrechtlich ohnehin nur beschränkt überprüfbaren – Feststellungen des Amtsgerichts der Fall. Das Handeln des Betroffenen stellt in subjektiver Hinsicht kein besonders vorwerfbares Verhalten dar. Nach den amtsgerichtlichen Feststellungen neigte der Angeklagte aufgrund der von ihm eingenommenen Medikation zu einem erhöhten Harndrang, der bereits kurz nach Beginn des Staus einsetzte. Zudem ist er im Hinblick auf den wiedereinsetzenden Verkehr davon ausgegangen, die Rettungsgasse bereits wieder befahren zu dürfen. Insoweit liegt zwar weder ein Notstand i.S.v. § 16 OWiG noch ein Erlaubnistatbestandsirrtum vor. Allerdings befand sich der Betroffene in einer – durch Medikamentenwirkung hervorgerufenen – notstandsähnlichen Situation; dazu hat das Amtsgericht festgestellt, dass zum Tatzeitpunkt bereits ein erheblicher Harndrang bzw. Druckgefühl vorhanden war (vgl. UA S. 6). Entgegen der Ansicht der Generalstaatsanwaltschaft konnte der Betroffene auch nicht etwa seine Notdurft außerhalb des Fahrzeugs verrichten. Denn – worauf die Verteidigung in ihrer Stellungnahme zur Antragsschrift zu Recht hinweist – ein Betreten der Autobahn ist grundsätzlich nicht erlaubt (§ 18 Abs. 9 StVO). Außerdem wäre ihm dieses Handeln unter dem Gesichtspunkt naheliegender Eigengefährdung rechtlich nicht zumutbar gewesen.
Des Weiteren war seine Pflichtverletzung als Fahrzeugführer in subjektiver Sicht infolge der – irrigen – Annahme der Verkehrsfreigabe nicht besonders verantwortungslos. Der Einwand der Generalstaatsanwaltschaft, der Betroffene habe durch sein Verhalten die Notstandslage erst herbeigeführt, verfängt nicht. Ausweislich der Feststellungen verspürte er den Harndrang bereits fünf Minuten, nachdem der Stau einsetzte. Es gehört jedenfalls nicht zu den Pflichten eines Fahrzeugführers, seine Toilettenverhalten bzw. Toilettengangintervalle nach einem unvorhersehbaren Stauereignis auszurichten.
Letztlich ist auch zu berücksichtigen, dass der Erfolgsunwert infolge der zwischenzeitlich erfolgten Verkehrsfreigabe objektiv nicht von besonderem Gewicht war.